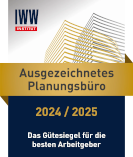19.07.2019 · IWW-Abrufnummer 210012
Oberlandesgericht München: Urteil vom 16.02.2016 – 9 U 4919/12
Diese Entscheidung enthält keinen zur Veröffentlichung bestimmten Leitsatz.
Oberlandesgericht München
IM NAMEN DES VOLKES
In dem Rechtsstreit
…
- Klägerin, Widerbeklagte und Berufungsbeklagte -
Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte …
gegen
…
- Beklagte, Widerklägerin und Berufungsklägerin -
Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt …
wegen Forderung
erlässt das Oberlandesgericht München - 9. Zivilsenat - durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht …, die Richterin am Oberlandesgericht … und den Richter am Oberlandesgericht … auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 01.12.2015 folgendes
Endurteil
Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf 214.107,22 € festgesetzt.
Gründe:
I.
3. Es wird festgestellt, dass die Klägerin der Beklagten zum Ersatz sämtlichen über die Anträge zu Ziffer 1 und 2 hinausgehenden Schadens aufgrund der nicht vertragsgemäß errichteten Keller am L.weg 9 und 11 in E. verpflichtet ist.
II.
b)
2.
III.
Az.: 9 U 4919/12 Bau
2 O 6517/07 LG München I
IM NAMEN DES VOLKES
In dem Rechtsstreit
…
- Klägerin, Widerbeklagte und Berufungsbeklagte -
Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte …
gegen
…
- Beklagte, Widerklägerin und Berufungsklägerin -
Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt …
wegen Forderung
erlässt das Oberlandesgericht München - 9. Zivilsenat - durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht …, die Richterin am Oberlandesgericht … und den Richter am Oberlandesgericht … auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 01.12.2015 folgendes
Endurteil
- Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts München I vom 09.11.2012, Az. 2 O 6517/07, wird zurückgewiesen.
- Die Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
- Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Das in Ziffer 1 genannte Urteil des Landgerichts München I ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des insgesamt vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.
- Die Revision gegen dieses Urteil wird nicht zugelassen.
Beschluss
Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf 214.107,22 € festgesetzt.
Gründe:
I.
Die Beklagte beauftragte die Klägerin 2006 mit der Rohbauerrichtung von zwei Systemkellern für ein Bauvorhaben Doppelhaus am L.weg 9 und 11 in E. Die Klägerin machte hierfür ihren Werklohn geltend, zunächst 75.182,68 Euro. Nach Klageerhebung einigten sich die Parteien auf eine Höhe des Werklohns von 69.987,92 Euro. Hinsichtlich des weitergehenden Betrags wurde die Klage in erster Instanz übereinstimmend für erledigt erklärt. Die Beklagte behauptete Mängel und verlangt Schadensersatz in den Werklohn übersteigender Höhe. Sie rechnete gegen den Werklohn auf und machte weitergehenden Schaden im Wege der Widerklage geltend.
Das Erstgericht verurteilte mit Endurteil vom 9.11.2012 die Beklagte zur Zahlung von 69.987,92 Euro nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 24.3.2007 und wies die Widerklage ab. Auf die tatsächlichen Feststellungen des Ersturteils wird Bezug genommen.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Beklagten, die ihre Anträge aus erster Instanz weiter verfolgt und beantragt, das landgerichtlich Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen. Hinsichtlich der Widerklage beantragt sie:
1. Die Klägerin wird verurteilt, an die Beklagte 124.119,30 Euro nebst 8% Zinsen über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.
2. Hilfsweise: Die Klägerin wird verurteilt, an die Beklagte weitere 69.987,92 Euro nebst 8% Zinsen über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.3. Es wird festgestellt, dass die Klägerin der Beklagten zum Ersatz sämtlichen über die Anträge zu Ziffer 1 und 2 hinausgehenden Schadens aufgrund der nicht vertragsgemäß errichteten Keller am L.weg 9 und 11 in E. verpflichtet ist.
Die Widerklage wurde am 23.1.2012 zugestellt.
Die Klägerin beantragt Zurückweisung der Berufung.
Die Beklagte macht geltend, das Werk sei unstreitig nicht abgenommen. Die Klägerin müsse daher die Dichtheit der weißen Wanne beweisen. Das sei ihr nicht gelungen. Die Klägerin habe teilweise die Anschlussbewehrung von der Bodenplatte zu den aufgehenden Wänden abgeschnitten. Mit einer Ersatzlösung in Form von Dübeln mit Gewindestangen hätte sich die Beklagte nur unter dem Vorbehalt einverstanden erklärt, dass diese Ausführung abzunehmen sei. Das sei vor dem Betonieren nicht geschehen. Auch der Sachverständige könne nicht feststellen, dass die Konstruktionsänderung mangelfrei eingebaut worden sei. Es liege daher ein Mangel vor. Dass eine Freigabe zum Betonieren von Seiten der Beklagten erfolgt sei, sei nicht unstreitig, sondern konkludent bestritten gewesen. Im Falle einer Behandlung als unstreitig hätte das Erstgericht darauf hinweisen müssen. Die Freigabe zum Betonieren sei auch nicht bewiesen. Bei dieser Sachlage liege im Betonieren ohne Freigabe eine Beweisvereitelung.
Im Übrigen sei wegen weiterer Ausführungsmängel das Werk nicht ordnungsgemäß errichtet und die Dichtigkeit der weißen Wanne nicht gewährleistet. Es müsse daher eine Nachbesserung erfolgen in Form einer äußeren Fugenabdichtung, ferner müsse eine Leckmeldeanlage eingebaut werden. Es entstehe durch den Mangel eine merkantile Wertminderung in Höhe von 100.000 Euro. Insgesamt stünden der Beklagten Schadensersatzforderungen in Höhe von 189.427,22 Euro zu. Die Beklagte habe mit diesen Forderungen in näher genannter Reihenfolge gegen die Klageforderung aufgerechnet. Ferner bestehe eine weitere Schadensersatzforderung in Höhe von 7.700,-- Euro aufgrund vergessenen Einbaus der ISO-Körbe und Anschlussbewehrungen und der nicht ausgeführten Eingangspodeste. Über die Hilfswiderklage sei zu Unrecht nicht entschieden worden. Nachdem die Schadensersatzansprüche begründet seien, sei der Widerklage und der Hilfswiderklage stattzugeben.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die in der Berufungsinstanz gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und die Protokolle vom 30.7.2013 und 1.12.2015 Bezug genommen.
II.
Die Berufung der Beklagten ist unbegründet.
Das Erstgericht ist zu Recht von einer Fälligkeit der Klageforderung ausgegangen. Nachdem die Beklagte keine Mängelbeseitigung begehrt, sondern mit Schadensersatzansprüchen aufrechnet, bedarf es für die Fälligkeit keiner Abnahme. Auf die Begründung des Ersturteils wird insoweit Bezug genommen.
Hinsichtlich der Mängel 2-12 gemäß Klageerwiderung haben sich die Parteien auf eine Nachbesserung geeinigt. Ferner haben sie sich auf die Höhe des Restwerklohns von 69.987,92 Euro (brutto) geeinigt.
1.
Die Aufrechnung gegen diese Klageforderung wegen weiterer Mängel bleibt ohne Erfolg.
a)
Mit dem Erstgericht ist davon auszugehen, dass eine Abnahme der Bauleistungen durch die Beklagte nicht erfolgt. Daher muss die Klägerin die Mangelfreiheit des Werks beweisen. Dies ist ihr jedoch letztlich gelungen. Dabei ist allerdings nicht allen denkbaren Mängeln nachzugehen, sondern nur solchen, die die Beklagte geltend gemacht hat. Die in der Klageerwiderung genannten Mängel Nr. 1, 13 bis 16 liegen nicht vor.
Mangel Nr. 1 betrifft die kraftschlüssige Verbindung zwischen den Elementwänden und dem zwischen diesen eingefüllten Kernbeton. Hierzu hat der Sachverständige bei der ersten Begutachtung selbst drei Bohrproben entnommen, von denen zwei keine Unregelmäßigkeiten aufwiesen, während ein Bohrkern eine Unregelmäßigkeit zwischen der Innenwandschale und dem Kernbeton aufgewiesen habe, ohne dass es hier zu einem Bruch gekommen sei. Soweit die Beklagte unter Vorlage der Anlage B 12 auf einen von ihr entnommenen Bohrkern hingewiesen habe, sei in der Übergangszone zwischen innerer Wandschale und Kernbeton augenscheinlich keine Störung erkennbar, dagegen sei im äußeren Bereich der Wandschale eine Bruchfuge zwischen Kernbeton und Wandschale erkennbar, wobei dem Bild nicht zu entnehmen sei, ob die Bruchfuge unmittelbar in der Übergangszone oder innerhalb des Kernbeton liege. Insoweit könne er wegen der Nichtvorlage des Bohrkerns und der schlechten Qualität der von dem Bohrkern überlassenen Bilder keine genaueren Angaben machen. Es sei bei der Vielzahl der zu betonierenden Wandflächen bauüblich nicht auszuschließen, dass kleinere Störstellen entstehen könnten.
Mangel Nr. 13 betrifft die Außenfugen der Elementwände mit der Behauptung, diese seien teilweise bis zu 6,5 cm Tiefe nicht ausbetoniert, so dass keine ausreichende Betondeckung der Bewehrung gegeben sei. Nach Feststellung des Sachverständigen stellten die vorhandenen Fugen von bis zu 25 mm Breite und 30mm Tiefe (an einer Wandecke 20mm Tiefe) keinen Mangel dar. Eine Fuge mit größerer Tiefe sei nicht vorgefunden und nicht gezeigt worden. Eine horizontale Stoßbewehrung an den Elementwandstößen sei nach Angabe der Klägerin nicht eingebaut worden und sei auch nicht erforderlich. Für die Dichtigkeit seien Fugenbänder oder Fugenbleche innerhalb des Betons einzulegen. Solche seien an den Stellen, wo Öffnungen vorgenommen worden seien, und an den Gebäudeecken aufgefunden worden. Von einem Mangel sei daher nicht auszugehen.
Mangel Nr. 14 betrifft die Abstandsfuge zwischen Bodenplatte und Kellerwänden. Hier hat der Sachverständige mehrere Messungen vorgenommen und im Durchschnitt eine Abstandhöhe von 30,6 mm gemessen. Soweit an zwei Stellen der Abstand nur 20mm betrug, hat der Sachverständige ausgeführt, diese geringe Abweichung gegenüber den vorgeschriebenen 30mm sei zu tolerieren, entscheidend sei die Dichtigkeit der umlaufenden Mörtelschicht. Diese sei gegeben.
Mangel Nr. 15 betrifft die Anschlussbewehrung zwischen Bodenplatte und Kellerwänden. Insoweit geht der Senat davon aus, dass eine Teilabnahme der Bewehrung nicht stattgefunden hat. Soweit die Berufung das die Annahme des Erstgerichts angreift, es habe unstreitig eine Zustimmung zum Weiterbetonieren vorgelegen, ohne darauf hinzuweisen, dass diese Zustimmung und die Teilabnahme gesondert gewürdigt werden könne, ist das nicht von der Hand zu weisen. Auch die Würdigung der Beweisaufnahme, dass eine solche Zustimmung erteilt worden sei, erscheint nicht frei von Zweifeln. Letztlich kommt es darauf jedoch nicht an, da der Senat auf Grund der Begutachtung davon ausgeht, dass hinsichtlich der Anschlussbewehrung ein Mangel der Bauleistung letztlich nicht vorliegt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Sachverständige ausgeführt hat, die Anschlussbewehrung habe nichts mit der Dichtigkeit im Bereich der Boden-/Wandfuge zu tun, die Dichtigkeit in diesem Bereich werde im Wesentlichen durch das dort eingelegte Fugenband gewährleistet. Die Anschlussbewehrung diene der Standsicherheit des Kellers.
Insoweit lägen Berechnungen vor, die die Standsicherheit auch hinsichtlich der veränderten Ausführung, bei der ursprüngliche Bewehrung durch nachträglich eingebrachte Stäbe ersetzt worden sei, belegen würden. Solche seien einerseits auf Bildern aus der Bauzeit sichtbar, ferner seien vom Sachverständigen Messungen mit dem zerstörungsfreien Georadar-Verfahren veranlasst worden. Dabei sei an allen gemessenen Stellen eine gewisse Anschlussbewehrung erkennbar, an den durch Fotos aus der Bauzeit dargestellten Stellen sogar in überdurchschnittlichem Maße.
Mangel Nr. 16 betrifft das Vorliegen einer ordnungsgemäßen weißen Wanne. Insoweit hat der Sachverständige festgestellt, dass alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, die die für eine weiße Wanne geforderte Betongüte belegen, insbesondere hinsichtlich der Betonsorte, des verwendeten Größtkorns und Feststellungen zur Druckfestigkeit des Betons.
Schließlich hat der Sachverständige noch abschließend zur Dichtigkeit der weißen Wanne Stellung genommen. Er hat in diesem Zusammenhang noch ergänzende Untersuchungen hinsichtlich des Verbunds zwischen den Elementwänden und dem Kernbeton (siehe auch Mangel 1) bzw. des Vorliegens etwaiger Hohlstellen vorgenommen, indem er flächig Ultraschallmessungen durchführen ließ. Diese 7 Messungen hatten zum Ergebnis, dass teils keine Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, teils bei den Messstellen 2 und 3 lokale Hohl-/Störstellen vorgefunden wurden. In der Gesamtbewertung wurden diese aber dahingehend beurteilt, dass mittlere bis grobe Hohllagen nicht festzustellen waren, sondern nur solche, die sich im üblichen Rahmen bei der Herstellung von Elementwänden bewegen. Bei dem festgestellten Maß des Vorliegens solcher Stellen besteht im Hinblick auf den dichten Abschluss der Boden-/Wandanschlussfuge und der entsprechenden Bearbeitung der Stoßfugenbereiche keine Befürchtung, das Druckwasser in der Wand hinterläufig wird. Angesichts der Tatsache, dass keine Undichtigkeiten festgestellt wurden, sei es auch nicht geboten gewesen, durch Bohrkernentnahme weitere Untersuchungen vorzunehmen.
Insgesamt ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen, dass die beiden Keller im Herbst 2006 betoniert wurden. Während der Bau zunächst einige Zeit nicht fortgeführt wurde, bei der ersten Begutachtung durch den Sachverständigen am 14.7.2008 zunächst 73 cm Wasser im Keller standen und im zweiten Ortstermin am 23.7.2008 das Wasser abgepumpt wurde, aber die Trockenheit des Keller noch nicht beurteilt werden konnte, wurde in der Folgezeit, wie die Beklagte im Termin vom 30.7.2013 mitteilte, der Bau fertiggestellt. Bei der erneuten Begutachtung mit Ortsterminen am 15.4. und 9.5.2014 konnte der Sachverständige P. keine Undichtigkeiten oder Nässeerscheinungen an den Bauteilen feststellen.
Auch die Beklagte konnte keine Feuchtigkeitserscheinungen aufzeigen.
Der Sachverständige hat daher in seinem Gutachten vom 11.11.2014 zusammenfassend festgestellt, angesichts der verstrichenen Zeit von acht Jahren seit der Errichtung des Baues und der Tatsache, dass keine Undichtigkeiten, insbesondere im Bereich der Boden-/ Wandanschlussfuge erkannt wurden, seien die festgestellten Unregelmäßigkeiten auf Grund von Erfahrungen mit ähnlichen Bauwerken als durchaus üblich und nicht schadensrelevant für eine Undichtigkeit des Kellers anzusehen. Angesichts der 8 Jahre auf das Bauwerk einwirkenden Wasserbelastung könne nicht von einer Mangelhaftigkeit ausgegangen werden.
Der Sachverständige hat ferner darauf hingewiesen, dass anlässlich der letzten Begutachtung ein Wasserstand von 48 cm über dem Rohkellerfußboden auf die Kellerwände eingewirkt habe. Angesichts dieses bereits von Natur aus bestehenden Wasserdrucks auf das Bauwerk habe er eine zusätzliche Wasserdruckprobe zur Beurteilung der Dichtigkeit nicht veranlasst.
Der Senat folgt auch in einer Gesamtbeurteilung dem überzeugenden Gutachten darin, dass der Keller keine Mängel aufweist, die einer Beseitigung bedürften, und kann auch nicht die Grundlage für das Vorliegen eines merkantilen Minderwerts erkennen.
Soweit der Beklagte mit Schriftsatz vom 9.2.2015 vorgetragen hat, es seien im Januar 2015 Wandfeuchtigkeit bzw. Wassereintritt aufgetreten und also Undichtigkeiten im Bereich der Boden-/Wandanschlüsse vorhanden, und soweit er Ausführungen zum Gutachten vom 11.11.2014 gemacht und eine Anhörung des Sachverständigen beantragt hat, hat der Senat zunächst am 12.12.2015 die Erholung eines weiteren Gutachtens angeordnet und der Beklagten, da sie die ergänzende Tätigkeit des Sachverständigen beantragt hat, die Einzahlung eines Kostenvorschusses von 2000 Euro aufgegeben.
Die Beklagte hat dann mit Schriftsatz vom 16.3.2015 den Einwand hinsichtlich des Auftretens von Wandfeuchtigkeit und Wassereintritt wieder fallen gelassen, da die Feuchtigkeitserscheinungen durch einen Mieter verursacht worden seien. Der Senat hat daraufhin den angeforderten Auslagenvorschuss auf 1.000 Euro herabgesetzt und die Einzahlungsfrist bis 27.3.2015 verlängert. Trotz nochmaliger Verlängerung der Einzahlungsfrist bis 9.6.2015 und des Hinweises, dass bei Nichtzahlung Termin bestimmt werde, ohne dem Sachverständigen die Beantwortung der gestellten Fragen aufzugeben, wurde der Vorschuss von der Beklagten nicht bezahlt. Von einer nochmaligen Beauftragung des Sachverständigen und dessen Anhörung im letzten Termin wurde daher abgesehen.
Ohne Erfolg bleibt die Aufrechnung mit einem Schadensersatzanspruch in Höhe von 7.700 Euro wegen unterlassenen Einbaus von ISO-Körben und nicht ausgeführter Eingangspodeste. Insoweit hat die Klägerin bestritten, dass die Anbringung der Eingangspodeste Vertragsinhalt gewesen sei.
Das Gegenteil konnte die Beklagte nicht hinreichend dartun. Auf die Vorlage des Grundrissplans des Erdgeschosses allein kann nicht abgestellt werden, zumal sich aus diesem nicht die Art der Ausführung des Eingangspodestes als Betonpodests ergibt. Der Vertragsschluss erfolgt auf der Basis des Angebots vom 23.9.2006, das auf eine beigefügte Baubeschreibung Bezug nahm. In dieser ist die Anbringung von Eingangspodesten nicht vorgesehen. Auch der Deckenplan der Decke über dem KG (Anlage K 19, zum Schriftsatz vom 6.5.2008) weist keine Eingangspodeste und deren Anschlussbewehrung aus.
Aus den vorstehenden Ausführungen folgt zugleich, dass die Widerklage unbegründet ist. Über die Hilfswiderklage musste nicht entschieden werden, da der Eventualfall (Abweisung der Klage, ohne dass die Widerklageansprüche verbraucht sind) nicht eingetreten ist.
III.
Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, §§ 711, 709 Satz 2 ZPO.
Die Revision wird nicht zugelassen, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen (§ 543 Abs. 2 ZPO). Die vorliegende Sache hat keine grundsätzliche, über den Einzelfall hinaus reichende Bedeutung. Eine Entscheidung des Revisionsgerichts ist auch nicht zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten.
Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf § 63 Abs. 2, § 47, § 48 Abs. 1 GKG, §§ 3, 4 ZPO. Der Streitwert bemisst sich nach der Klageforderung von 69.987,92 Euro. Hinzuzurechnen ist die Widerklageforderung von 124.119, 30 gemäß Widerklageantrag Ziffer 1 und der Wert der Feststellung nach Widerklageantrag Ziffer 3 in Höhe von 20.000 Euro wie in erster Instanz gemäß Bewertung durch die Beklagte bei Antragstellung. Der Wert der Hilfswiderklage (Antrag Ziffer 2 der Widerklage) ist nicht hinzuzurechnen, da der Eventualfall nicht eingetreten ist und deshalb darüber nicht entschieden wurde. Die Aufrechnung gegen die Klageforderung in derselben Höhe von 69.987,92 Euro ist primär erfolgt, wie auf Seite 19 der Klageerwiderung ausdrücklich erklärt. Es kommt daher nicht zur Anwendung des § 45 Abs. 3 GKG, auch nicht, obwohl die Aufrechnungsforderung damit aberkannt wird (§ 322 Abs. 2 ZPO).