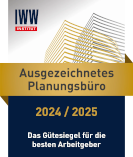21.02.2022 · IWW-Abrufnummer 227658
Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen: Beschluss vom 09.02.2022 – 2 B 1964/21
Diese Entscheidung enhält keinen zur Veröffentlichung bestimmten Leitsatz.
Tenor:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.
Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 5.000,00 Euro festgesetzt.
Gründe
Die Beschwerde hat keinen Erfolg.
Die in der Beschwerdebegründung dargelegten Gründe, auf deren Prüfung der Senat nach § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, führen zu keiner Änderung der angefochtenen Entscheidung.
Das Verwaltungsgericht hat den Antrag der Antragstellerin,
die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Bescheid vom 24. November 2021 hinsichtlich der Untersagungen zu Ziff. 1 wiederherzustellen und hinsichtlich der Zwangsmittelandrohung zu Ziff. 2 anzuordnen,
im Wesentlichen mit der Begründung abgelehnt, weder sei die angefochtene Verfügung offensichtlich rechtswidrig noch überwiege das Interesse der Antragstellerin aus sonstigen Gründen. Die Verfügung der Antragsgegnerin dürfte sich auf §§ 82 Satz 2, 60 Abs. 1 BauO NRW stützen können. Eine Nutzungsänderung sei nicht ernstlich zweifelhaft. Die Antragstellerin trage vor, dass ein vormals industriell genutztes Gebäude nunmehr von ihr als Künstleratelier genutzt werde. Dafür, dass die Antragstellerin die Nutzungsänderung herbeigeführt habe, sprächen die von der Antragsgegnerin angeführten Bestimmungen des Kaufvertrages. Ohne Erfolg mache die Antragstellerin geltend, sie habe den erforderlichen zweiten Rettungsweg angelegt und einen Stall beseitigt. Entscheidend komme es darauf an, dass die Genehmigungsvoraussetzungen (zwei Rettungswege und gegebenenfalls weitere Bedingungen) in dem dafür vorgeschriebenen Baugenehmigungsverfahren geprüft werden müssten, an dem es hier fehle. Dies würde in gleicher Weise für etwaige bauliche Änderungen gelten. Sei eine Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen nach wie vor erforderlich, stehe einer Nutzungsuntersagung grundsätzlich nichts entgegen. Als unverhältnismäßig erscheine sie erst dann, wenn ein Genehmigungsantrag gestellt worden sei - woran es hier bereits fehle - und dieser nach Auffassung der Genehmigungsbehörde genehmigungsfähig sei. Der Vorwurf unzureichender Akteneinsicht sei schließlich ebenfalls nicht geeignet, Bedenken gegen die Verfügung zu begründen. Selbst wenn er zuträfe, wäre die Antragstellerin angesichts der auch von ihr vorausgesetzten Nutzungsänderung gleichwohl gehalten gewesen, entsprechende Genehmigungsunterlagen beizubringen.
Dieser Bewertung setzt die Beschwerde nichts Erhebliches entgegengesetzt, das nach Maßgabe des § 80 Abs. 5 VwGO eine andere Interessenabwägung rechtfertigen könnte. Insbesondere stellt sie die zutreffende Annahme des Verwaltungsgerichts zur formellen Illegalität der untersagten Nutzung nicht durchgreifend in Frage, auf die sich die angegriffene Nutzungsuntersagung ausweislich der Ausführungen zur rechtlichen Würdigung und zur Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung maßgeblich und selbständig tragend stützt.
Der Vorhalt, die Antragsgegnerin kenne nach eigenen Angaben den "konkreten Genehmigungsstatus" für die hier in Rede stehenden Baulichkeiten selbst nicht und könne sich deshalb nicht darauf berufen, die jetzige Nutzung der Gewerberäume widerspreche dem Genehmigungsstatus, greift zu kurz.
Er lässt schon außer Acht, dass für das Vorliegen einer Baugenehmigung derjenige darlegungs- und beweispflichtig ist, der sich gegenüber einer Nutzungsuntersagung darauf beruft, diese Nutzung sei genehmigt und deshalb formell baurechtmäßig. Entsprechendes gilt bezüglich eines behaupteten Bestandsschutzes.
Vgl. nur Beck-OK BauO NRW, 10. Edition, § 74 Rn. 106 mit zahlreichen Nachweisen auf die einheitliche Rechtsprechung
Insofern obliegt es der Antragstellerin und nicht der Antragsgegnerin, die Baugenehmigung beizubringen. Es war also an der Antragstellerin, sich vor der Nutzungsaufnahme zu vergewissern, dass diese von der Baugenehmigung gedeckt ist, oder einen Bauantrag zu stellen. Beides ist hier offenkundig nicht geschehen. Dafür kann die Antragstellerin indes die Antragsgegnerin nicht verantwortlich machen.
Zwar kann, selbst wenn die Baugenehmigungsurkunde nicht vorgelegt werden kann, im Einzelfall aufgrund der besonderen konkreten Umstände - ohne Beweislastentscheidung - von einer legalen Errichtung eines Gebäudes einschließlich der aufgenommenen Nutzung auszugehen sein, beispielsweise, wenn in der gegebenen Grundstückssituation die Errichtung eines formell und materiell illegalen Gebäudes in den vorhandenen Dimension in innerstädtischer Lage "unter den Augen der Baupolizei" schwer vorstellbar wäre.
Vgl. dazu: BVerwG, Beschluss vom 12. Januar 1995 - 4 B 197.94 -, BRS 57 Nr. 131 = juris Rn. 10; OVG NRW, Beschluss vom 11. Juli 2011 - 7 B 634/11 -, juris Rn. 7, und Urteil vom 17. Januar 2008 - 10 A 2795/05 -, BRS 73 Nr. 172 = juris Rn. 71 ff.; B. Schulte, in: Boeddinghaus/Hahn/Schulte u. a., Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Band IV, Stand Juni 2020, § 74 Rn. 205 ff.
Danach mag hier von einer legalen Errichtung der Hallen für das produzierende Gewerbe (auch die Antragstellerin spricht von Fabrikhallen) ausgegangen werden und mag auch noch die Nutzung zur Produktion von Elektromotoren mit mechanischen Steuerschützen legal gewesen sei, die nach eigenen Angaben der Antragstellerin ihr Rechtsvorgänger hat auslaufen lassen, bevor sie das Grundstück erworben und die streitige Nutzung als Künstleratelier aufgenommen hat. Daraus lässt sich eine Legalisierung der streitigen Nutzung aber nicht ableiten. Der Hinweis darauf, dass es sich gleichermaßen um gewerbliche Nutzung handelt, verfängt ebenso wenig wie der Hinweis darauf, dass sich die Nutzung der Hallen als Atelier im Verhältnis zur vorherigen Nutzung im Rahmen eines produzierenden Gewerbes weniger belastend auf die Umgebung, namentlich die benachbarte Wohnnutzung auswirke.
Selbst wenn - was hier allerdings rein spekulativ erscheint - eine ursprüngliche Genehmigung, keine konkrete Festlegung auf eine Nutzung der Hallen als Produktionsstätte beinhaltet haben sollte, gingen von dieser, soweit sie Nutzungen mit anderer Zweckrichtung erfasst haben sollte, keine Rechtswirkungen mehr aus, nachdem von ihr insoweit über Jahrzehnte kein Gebrauch gemacht worden ist. Sie hätte insoweit ihre Erledigung gefunden.
Dass sich die Nutzung einer Halle als Produktionsstätte maßgeblich von der eines Künstlerateliers mit - wenn auch reduziertem - Publikumsverkehrs (auch zu Verkaufszwecken) unterscheidet und rechtlich eine Nutzungsänderung darstellt, die genehmigungspflichtig ist, bedarf dabei keiner Hervorhebung. Ein Nutzungsänderung i. S. d. § 60 Abs. 1 BauO NRW bzw. § 63 Abs. 1 BauO NRW a. F. liegt immer schon dann vor, wenn sich die neue Nutzung von der bisherigen (legalen) Zweckbestimmung dergestalt unterscheidet, dass sie anderen oder weitergehenden Anforderungen bauordnungs- oder bauplanungsrechtlicher Art unterworfen ist oder unterworfen werden kann, d. h. schon dann, wenn die Möglichkeit besteht, dass die Zulässigkeit des geänderten Vorhabens nach den Bauvorschriften anders beurteilt werden kann.
Vgl. OVG NRW, Urteil vom 21. November 2005 - 10 A 1166/04 -, BRS Nr. 69 Nr. 100 = juris Rn. 35; Schulte N., in: Boeddinghaus/Hahn/Schulte u.a., Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Band IV, Stand Oktober 2020, § 60 Rn. 21 f., m. w. N.
Daran bestehen hier schon mit Blick auf die Prüfung der brandschutzrechtlichen Anforderungen keine Zweifel. Die Nutzung unterscheidet sich gerade wegen des vorgestellten Publikumsverkehrs von der einer Produktionsstätte, wobei die konkrete Ausgestaltung von dem Betriebsgeschehen abhängen dürfte. Auch in bauplanungsrechtlicher Hinsicht liegt die Möglichkeit nahe, dass die streitige Nutzung anderen Vorgaben unterliegt als die für ein produzierendes Gewerbe, weil von einer anderen Nutzungsart auszugehen ist. Die frühere Nutzung dürfte unter Berücksichtigung auch der Größe der Hallen bei typisierender Betrachtung kaum zu den nicht wesentlich störenden und damit mischgebietsverträglichen Betrieben und keinesfalls zu den nicht störenden Gewerbebetrieben zu zählen gewesen sein. Die neuerliche Nutzung der Hallen dürfte demgegenüber je nach Ausgestaltung als freiberufliche Tätigkeit i. S. d. § 13 BauNVO, kulturelle Anlage und/oder als nicht störender, jedenfalls nicht wesentlich störender Gewerbebetrieb und/oder (Kunst-)Einzelhandel zu bewerten sein.
Vgl. zu § 13 BauNVO: Bay. VGH, Urteil vom 2. Januar 2008 - 1 BV 04.2737 -, juris Rn. 33 (Atelier eines Bildhauers); Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB Kommentar, Band VI, Stand Mai 2018, § 13 BauNVO Rn. 19 (freie Kulturberufe); Fickert/Fieseler, BauNVO, 13. Auflage, § 13 Rn. 4 (Maleratelier).
Die damit formell illegale Nutzung konnte - anders als die Beschwerde meint - auf der Grundlage des § 82 Abs. 1 BauO NRW wie regelmäßig und so auch hier rechts- und ermessensfehlerfrei untersagt werden. Es entspricht der ständigen Rechtsprechung der Bausenate des beschließenden Gerichts, dass bereits eine formelle Illegalität eines Vorhabens im Regelfall eine (sofort vollziehbare) Nutzungsuntersagung trägt. Eine Unverhältnismäßigkeit kommt nur dann in Betracht, wenn der erforderliche Bauantrag gestellt, er (auch) nach Auffassung der Baugenehmigungsbehörde genehmigungsfähig ist und auch sonst keine Hindernisse entgegenstehen.
Vgl. nur OVG NRW, Beschlüsse vom 02. Juni 2021 - 2 B 443/21 -, juris Rn. 13, vom 23. November 2020 - 10 A 2316/20 -, juris Rn. 9, und vom 24. September 2020 - 10 A 2167/20 -, juris Rn. 10, jeweils m. w. N.
Die besagte Rechtsprechung trägt dem besonderen Gewicht Rechnung, das der Ordnungsfunktion des formellen Bauaufsichtsrechts beizumessen ist und dessen Durchsetzung unter anderem verhindert, dass der - bewusst oder unbewusst - rechtswidrig Handelnde in bedenklicher, das Rechtsbewusstsein der Allgemeinheit erschütternder Weise gegenüber dem gesetzestreuen Bürger, der die Aufnahme einer genehmigungspflichtigen, aber bislang nicht genehmigten baulichen Nutzung nur auf der Grundlage einer vollziehbaren Baugenehmigung verwirklicht, bevorzugt wird. Diesem Aspekt der Ordnungsfunktion des formellen Bauaufsichtsrechts würde die von der Beschwerde in den Raum gestellte alternative Möglichkeit, der Antragstellerin nur aufzugeben, "auf der Basis der bestehenden Genehmigungslage gegebenenfalls einen Abänderungsantrag in Bezug auf die jetzt praktizierte Nutzung zu stellen", nicht vergleichbar Rechnung tragen. Wer eine formell illegale Nutzung aufnimmt oder die durch einen Dritten aufgenommene fortführt, muss vielmehr jederzeit damit rechnen, mit einem Nutzungsverbot und dessen Vollstreckung belegt zu werden.
Vgl. z. B. OVG NRW, Beschlüsse vom 19. Juli 2011 - 10 B 743/11 - und vom 6. Juni 2003 - 7 B 2553/02 -, juris Rn. 3.
Unbeschadet dessen fehlte es für die vorgestellte Anordnung, eine Baugenehmigung zu beantragen, an der erforderlichen Rechtsgrundlage, nachdem es die alleinige Verantwortung der Bauherrin ist, für ihr Vorhaben die erforderliche Baugenehmigung zu beantragen.
Vgl. hierzu Beck-OK BauO NRW, 10. Edition, § 74 Rn. 106, m. w. N.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO.
Die Streitwertentscheidung ergibt sich aus §§ 47 Abs. 1 und 3, 52 Abs. 1, 53 Abs. 2 GKG. Dabei orientiert sich der Senat an Ziff. 11 des Streitwertkatalogs der Bausenate des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen vom 22. Januar 2019 (BauR 2019, S. 610), der für den Streitwert bei einem Nutzungsverbot auf den Jahresnutz- oder Jahresmietwert verweist. Davon ausgehend bewertet der Senat das Interesse der Antragstellerin an der mit der Anfechtungsklage verfolgten Möglichkeit, die Hallen auf ihrem Grundstück weiterhin ohne Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens als Künstleratelier (mit Werkstatt und Aus- bzw. Aufstellungsbereich sowie mit - wenn auch nach eigenen Angaben - geringem Publikumsverkehr) zu nutzen, gerade auch in Ansehung der Größe der Hallen mit 10.000 Euro; der Streitwert für das Eilbeschwerdeverfahren wird mit der Hälfte dieses Wertes angesetzt.
Dieser Beschluss ist unanfechtbar, § 152 Abs. 1 VwGO.