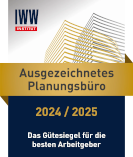22.01.2025 · IWW-Abrufnummer 246034
Oberlandesgericht Köln: Urteil vom 11.01.2024 – 7 U 39/23
Diese Entscheidung enthält keinen zur Veröffentlichung bestimmten Leitsatz.
Oberlandesgericht Köln, Urteil vom 11.01.2024, Az. 7 U 39/23
Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Köln vom 09.02.2023 (8 O 328/21) wird zurückgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens und 52 % der Kosten des selbständigen Beweisverfahrens LG Köln, 8 OH 7/20 werden dem Beklagten auferlegt. Von den Kosten der dortigen Nebenintervention tragen die Nebenintervenienten 52 % selbst.
Dieses und das angefochtene Urteil sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger zuvor Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf bis 280.000,00 € festgesetzt.
1
Gründe:
2
I.
3
Der Kläger begehrt von dem beklagten Architekten Kostenvorschuss und Schadensersatz wegen Mängeln an der Dachkonstruktion des klägerischen Bauvorhabens.
4
Das Baugrundstück stand ursprünglich im Eigentum einer aus dem Kläger und dessen Schwester bestehenden Erbengemeinschaft. Die Geschwister beauftragten den Beklagten in Bauherrengemeinschaft mit der Vollarchitektur, mit Ausnahme von Leistungsphase 9 nach HOAI, für den Neubau einer Unternehmervilla („Villa C.") O.-straße N03, N01 Z. T., auf Basis des schriftlichen Architektenvertrags vom 23.08.2011 (Anlage RSNP1, Bl. 219 ff. LGA).
5
Später verständigten sich die Geschwister darauf, dass der Kläger seiner Schwester ihren hälftigen Anteil an dem Baugrundstück abkaufen und das Bauvorhaben alleine fortführen solle. Unter dem 11.01.2013 erfolgte eine entsprechende Teil-Erbauseinandersetzung, mit der der Kläger das Baugrundstück zum Alleineigentum und Alleinbesitz erwarb. Danach übernahm er die Fortführung der Baumaßnahme als alleiniger Bauherr und Auftraggeber, womit der Beklagte einverstanden war und seine Tätigkeit für das streitgegenständliche Bauvorhaben nun ausschließlich für den Kläger erbrachte.
6
lm Zuge der Ausführungsplanung erstellte der Beklagte u.a. den Plan mit der Nr. N02 vom 10.10.2013, welcher die Detailplanung für die Errichtung eines Spitzbodens mit einer durchgehend ausgeführten Dampfbremse zwischen 1. OG und Spitzboden sowie zusätzlich zwischen Spitzboden und Dachkonstruktion sowie einer Dämmung zwischen Wohnraum und Spitzboden sowie zusätzlich einer Zwischensparrendämmung des Daches über dem Spitzboden beinhaltet (Anlage K1, Bl. 22 LGA).
7
Das Projekt wurde abgeschlossen und die Leistungen des Beklagten klägerseits abgenommen. Für seine Leistungen zahlte der Kläger an den Beklagten gem. der am 09.12.2016 übersandten Schlussrechnung insgesamt 358.646,77 € an Honorar.
8
Im Mai 2018 rügte der Kläger gegenüber dem Beklagten erstmalig Feuchtigkeitsschäden an der Dachuntersicht (außen). Nach Prüfung des gerügten Sachverhalts vor Ort durch eine Mitarbeiterin des Beklagten, die Zeugin L., gelangte die Beklagtenseite zu dem Schluss, dass keine Mängel vorlägen.
9
Hierauf schaltete der Kläger Rechtsanwalt B. aus der Kanzlei Dr. W. und Sozien GmbH ein, der mit Schreiben vom 11.06.2019 dem Beklagten eine Frist zur Mangelbeseitigung setzte. Der Beklagte wies mit E-Mail vom selben Tage eine etwaige Verantwortung zurück.
10
In der Folge konsultierte der Kläger den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Dachdeckerhandwerk G. H., der u.a. einen Blower-Door-Test bei gleichzeitiger Anwesenheit der Mitarbeiterin L. des Beklagten durchführte. Wegen der Ausführungen des Sachverständigen H. zu dem Ergebnis dieser Untersuchung wird auf seine E-Mail vom 24.09.2019 (Anlage K4, BI. 30 LGA) verwiesen. Am 04.10.2019 erfolgten Bauteilöffnungen und Probeentnahmen zwecks Überprüfung auf Schimmel- und Pilzbefall. Weiter entnahm der Sachverständige aus Anlass der Bauteilöffnungen auch Nägel aus der Schieferung und der Schalung. Es erfolgte sodann eine Untersuchung sowohl der Baustoffproben als auch der Nägel durch das Baustoffberatungszentrum (BZR) Rheinland, deren Ergebnisse dieses in seinem Prüfbericht/Gutachten vom 11.10.2019 aufführt. Wegen des Inhalts dieses Prüfberichts wird auf Anlage K6, BI. 52 ff LGA, verwiesen. Der Sachverständige H. stellte dem Kläger für seine Tätigkeit einschließlich der durch das Baustoffberatungszentrum (BZR) Rheinland entstandenen Kosten insgesamt 3.727,68 € in Rechnung.
11
Der Kläger ließ dem Beklagten mit Schreiben seiner jetzigen Prozessbevollmächtigten vom 25.11.2019 eine Frist zur Nachbesserung seiner Ausführungsplanung bzw. Erstellung einer Sanierungsplanung bis spätestens zum 15.01.2020 und eine weitere Frist zur Zahlung eines ersten Vorschusses von 50.000,00 € für die Mangelbeseitigung zzgl. Sachverständigen-, Labor- und Anwaltskosten bis spätestens zum 31.12.2019 setzen. Das vorgerichtliche Tätigwerden seiner jetzigen Prozessbevollmächtigten vergütete der Kläger mit 2.604,61 € brutto. Wegen des Vortrags der Klägerseite zur Höhe dieser Rechnung wird auf BI. 12 ff. LGA verwiesen.
12
Nachdem diese Fristen fruchtlos verstrichen waren, leitete der Kläger mit Antragsschrift vom 03.03.2020 das selbstständige Beweisverfahren zu Az. LG Köln 8 OH 7/20 ein. Der in diesem Verfahren bestellte Sachverständige X. erstattete dort im Hinblick auf den dortigen Beweisbeschluss vom 27.04.2020 sein Hauptgutachten vom 31.05.2021, welches der Kläger hier im Verfahren als Anlage K13 eingereicht hat. Wegen des näheren Inhalts dieses Gutachtens wird auf Anlage K13, Bl. 79 ff. LGA verwiesen.
13
Nach den Feststellungen des Sachverständigen X. sollen folgende, letztlich die gesamte Dachkonstruktion betreffende Zustände im Dachstuhl des Bauvorhabens vorliegen:
14
- korrodierte Nägel (Schieferstifte) der Dachdeckung aus Schiefer,
15
- Schimmelpilzbildung auf der Dachschalung, und zwar auf der Unterseite zur Dämmung zeigend, teilweise erhöhte Holzfeuchtigkeit im Bereich der Schalung und der Sparren
16
- Pilz- und Schimmelpilzbildung sowie durch zu hohe Untergrundfeuchtigkeit abblätternde Farbe im Bereich der profilierten Gesimse
17
- eine Vielzahl von Luftundichtigkeiten zwischen Spitzboden und Außen (Außenbereich)
18
- eine Vielzahl von Luftundichtigkeiten zwischen dem Obergeschoß und dem Spitzboden,
19
- Kondensatbildung/Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion.
20
Unter Bezugnahme auf die Ausführungen des Sachverständigen X. hat der Kläger behauptet, diese Erscheinungen seien auf Planungs- und Überwachungsfehler des Beklagten zurückzuführen, zu denen der Kläger näher vorgetragen und deren Vorhandensein sowie Schadenskausalität der Beklagte bestritten hat. Insbesondere hat der Kläger behauptet, die Undichtigkeiten seien darauf zurückzuführen, dass die Dampfsperre (Luftdichtigkeitsschicht) entgegen den allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) an unverputztes Mauerwerk angeschlossen worden sei, dass der Einsatz der hier verwendeten feuchtevariablen Dampfbremse zwischen dem Obergeschoss und dem Spitzboden (Dachstuhl) bei nicht fachgerechter Koordination mit den feuchtigkeitsträchtigen Arbeiten im Ober- und Erdgeschoss (Estrich- und Innenputzarbeiten) zu einer übermäßigen, fachwidrigen und schadensträchtigen Diffusion von Feuchtigkeit in den Dachstuhl führe und dass eine grundlegende konzeptionelle Fehlplanung und Ausführung seitens des Beklagten vorliege, mit der dieser die bauphysikalischen Verhältnisse regelwidrig und höchst schadensträchtig verändert habe.
21
Mit Blick darauf, dass der Sachverständige X. die Kosten für die Schadensbeseitigung und mangelfreie Herstellung eines warmen Dachraums mit 258.308,54 € beziffert hat, hat der Kläger diesen Betrag als schadensgleichen Kostenvorschuss vom Beklagten verlangt. Außerdem hat er von diesem Ersatz seiner vorgerichtlichen Rechtsanwalts-, Sachverständigen- und Laborkosten begehrt sowie die Feststellung der Ersatzpflicht des Beklagten für etwaige Folgeschäden.
22
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes bis zur Entscheidung in erster Instanz und der erstinstanzlich gestellten Anträge wird gemäß § 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen (Bl. 4 ff. OLGA).
23
Das Landgericht hat der Klage ohne Durchführung einer Beweisaufnahme vollumfänglich stattgegeben. Dies hat es im Wesentlichen wie folgt begründet: Das Architektenwerk des Beklagten sei mangelhaft, weil dessen Planung nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspreche. Er habe letztlich einen gedämmten, aber nicht beheizten Dachraum konstruiert, bei dem die Gefahr von Tauwasserbildung gegeben sei. Daher hätte er jedenfalls einen belüfteten Hohlraum über der durch die Unterdeckung abgegrenzten Ebene der Zwischensparrendämmung vorsehen müssen, der für die Abführung überschießender Feuchtigkeit gesorgt hätte. Den entsprechenden technisch plausiblen und fundierten Ausführungen des Sachverständigen, auf die der Kläger in seinem Vortrag Bezug nehme, sei der sachkundige Beklagte trotz Hinweises der Gegenseite nicht hinreichend substantiiert entgegentreten. Außerdem habe der Beklagte im Rahmen der Bauausführung seine ihn aus dem Architektenvertrag treffenden Überwachungspflichten verletzt. Hier spreche der Beweis des ersten Anscheins für einen Bauüberwachungsfehler, weil es sich um schwierige und gefahrträchtige Arbeiten handele und die vom Kläger vorgetragenen ‒ unstreitigen ‒ Zustände Baumängel darstellten. Entsprechendes gelte für den nicht hinreichend substantiiert bestrittenen Umstand, dass die eingebrachte Dampfbremse nicht den erforderlichen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis besitze. Es sei dem Beklagten nicht gelungen, diesen Anscheinsbeweis zu widerlegen, weil er trotz Hinweises der Gegenseite nicht hinreichend substantiiert dargetan habe, dass er seiner Verpflichtung zu einer ordnungsgemäßen Bauaufsicht nachgekommen sei. Was die Höhe des Kostenvorschusses angehe, sei der sachkundige Beklagte dem unter Bezugnahme auf die Ausführungen des Sachverständigen X. erfolgten substantiierten Vortrag der Klägerseite trotz Hinweises der Gegenseite ebenfalls nicht hinreichend substantiiert entgegengetreten. Wegen der weiteren Begründung wird gemäß § 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen (Bl. 4 ff. OLGA).
24
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung des Beklagten, mit der dieser seinen erstinstanzlichen Antrag auf Klageabweisung vollumfänglich weiterverfolgt. Der Beklagte meint, das Landgericht habe die Tatsachen, auch unter Verstoß gegen das Gebot rechtlichen Gehörs, nicht vollständig ermittelt, weil es diese allein aus dem Gutachten des Sachverständigen X. vom 31.05.2021 im selbständigen Beweisverfahren (8 OH 7/20) übernommen habe und die von ihm dort gestellten Ergänzungsfragen vom 10.08.2021 ‒ deren Inhalt er erstmals in der Berufungsbegründung wiedergibt ‒ unbeantwortet geblieben seien. Hierzu behauptet er ‒ vom Kläger unwidersprochen ‒, er sei aufgrund des bereits mit der Klageschrift gestellten Antrags auf Beiziehung des selbständigen Beweisverfahrens davon ausgegangen, dass sämtliche sachverständigen Feststellungen sowie Anträge auf rechtliches Gehör, insbesondere das Recht auf Beantwortung von Ergänzungsfragen, in die Entscheidung über den geltend gemachten Anspruch eingestellt würden, zumal das erkennende Gericht in beiden Verfahren identisch sei. Er meint, seine Beweisangebote in der Klageerwiderung hätten wenigstens dazu führen müssen, dass die Ergänzungsfragen noch beantwortet würden. Darauf beruhe auch das Urteil, denn sämtliche Ergänzungsfragen als auch die im Klageverfahren gemachten Beweisangebote hätten dazu geführt, dass der Kostenvorschussanspruch nicht bzw. nicht in dieser Höhe bejaht worden wäre. Außerdem hätte das Landgericht ein Mitverschulden des Klägers annehmen müssen, weil er diesen darauf hingewiesen habe, dass das Dach regelmäßig gewartet werden müsse, der Kläger dennoch keinen entsprechenden Wartungsvertrag abgeschlossen habe und die ordnungsgemäße Durchführung der Wartungsverträge, deren Gegenstand die regelmäßige Kontrolle der Funktion der feuchtevariablen Dampfbremse habe sein sollen, die Feuchtigkeitsschäden verhindert hätte. Seinen dazu bereits in erster Instanz erfolgten unstreitigen Vortrag habe das Landgericht gänzlich unbeachtet gelassen. Schließlich ist der Beklagte der Ansicht, es liege eine Überraschungsentscheidung vor, weil er aufgrund eines Beschlusses des Landgerichts im selbständigen Beweisverfahren vom 07.09.2022, laut dem sich der Sachverständige mit seinen Ergänzungsfragen auseinandersetzten sollte, davon habe ausgehen müssen, dass die Fragen noch beantwortet würden. Wenn das Landgericht der Meinung gewesen sei, dass eine Beweisaufnahme prozessual nicht angezeigt gewesen sei, hätte es zumindest den Beschluss vom 07.09.2022 aufheben oder einen deutlichen Hinweis dazu geben müssen.
25
Der Beklagte beantragt sinngemäß,
26
das am 09.02.2023 verkündete Urteil des Landgerichts Köln (Az. 8 O 328/21) abzuändern und die Klage abzuweisen.
27
Hilfsweise beantragt er,
28
das Urteil aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht zurückzuverweisen.
29
Der Kläger beantragt,
30
die Berufung zurückzuweisen.
31
Der Kläger verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vorbringens. Er meint, das Landgericht habe zu Recht angenommen, dass der sachkundige Beklagte trotz Hinweises des Klägers dem detaillierten Klagevortrag zu seinen Planungs- und Überwachungsfehlern nicht hinreichend substantiiert entgegengetreten sei und es deshalb einer Beweisaufnahme unter Beiziehung des OH-Verfahrens nicht bedurfte habe. Der Beklagte habe auch mit der Berufungsbegründung nicht vorgetragen, warum keine Planungs- und Überwachungsfehler vorlägen und/oder diese nicht schadenskausal geworden sein sollten. Allein die zitierten Ergänzungsfragen aus dem OH-Verfahren würden einen solchen Vortrag nicht ersetzen und diesen auch nicht beinhalten. Mit der Gehörsrüge habe der Beklagte aber konkreten, ihm vermeintlich abgeschnittenen Vortrag verbinden müssen. Jedenfalls sei das Ergebnis des Erstgerichts deshalb richtig, weil die Ergänzungsfragen zu keiner Korrektur der Ergebnisse des Gerichtssachverständigen X. geführt hätten. Hierzu behauptet der Kläger ‒ vom Beklagten unwidersprochen ‒, dieser Sachverständige habe mit dem mittlerweile vorliegenden 2. Ergänzungsgutachten vom 11.05.2023 sämtliche Ergebnisse des Hauptgutachtens (Anlage K 13) bestätigt. Außerdem meint der Kläger, ihn treffe keine Wartungsverpflichtung mit dem Inhalt der Kontrolle der Funktion der feuchtevariablen Dampfsperre. Der Vortrag des Beklagten dazu sei unsubstantiiert und widersprüchlich. Wegen der Einzelheiten wird auf S. 4 ff. der Berufungserwiderung (Bl. 160 ff. OLGA) Bezug genommen. Schließlich liege auch keine Überraschungsentscheidung vor, weil Entscheidungsreife gegeben gewesen sei und sich der Beklagte ausweislich der Berufungsbegründung lediglich in der irrigen Annahme befunden habe, vor Abschluss des OH-Verfahrens könne im Hauptsacheverfahren keine Entscheidung ergehen.
32
Mit Beschluss vom 23.11.2023 hat der Senat die Akten des selbstständigen Beweisverfahrens LG Köln, 8 OH 7/20, im Hinblick auf die hier streitgegenständlichen Mängel des Daches des Haupthauses zu Beweiszwecken beigezogen und diese zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht.
33
II.
34
Die zulässige Berufung des Beklagten hat in der Sache im Ergebnis keinen Erfolg. Zwar hat das Landgericht das Recht des Beklagten auf rechtliches Gehör verletzt, indem es ihn nicht darauf hingewiesen hat, dass es seinen Vortrag zu den im selbständigen Beweisverfahren gestellten Ergänzungsfragen für nicht hinreichend substantiiert hielt und deshalb unabhängig von dem Inhalt seiner Ergänzungsfragen und deren noch ausstehender Beantwortung zu entscheiden beabsichtigte. Das angefochtene Urteil beruhte auch auf diesem Gehörsverstoß, weil nicht auszuschließen war, dass die Entscheidung des Landgerichts anders ausgefallen wäre, wenn der Beklagte Gelegenheit gehabt hätte, den Inhalt der von ihm im selbständigen Beweisverfahren gestellten Ergänzungsfragen mitzuteilen. Nachdem der Beklagte dies zwischenzeitlich in der Berufungsbegründung nachgeholt und der Senat daraufhin Beweis erhoben hat, steht aber fest, dass das erstinstanzliche Urteil im Ergebnis zutreffend ist und daher keiner Abänderung bedarf. Im Einzelnen:
35
Das Landgericht hat letztlich zu Recht einen Anspruch des Klägers gegen den Beklagten auf Zahlung eines schadensgleichen Kostenvorschusses i.H.v. 258.308, 54 € aus §§ 633, 634 Nr. 4, 280 Abs. 1 BGB bejaht.
36
Der Beklagte hat eine Pflicht aus dem Architektenvertrag vom 23.08.2011 verletzt, weil er das von ihm erbrachte Architektenwerk mangelhaft erstellt hat. Ihm fallen sowohl Planungs- als auch Überwachungsfehler zur Last.
37
Das Landgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Planung der Dachkonstruktion durch den Beklagten nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht, weil der von ihm geplante gedämmte, jedoch ungeheizte Spitzboden weder den an einen kalten Dachraum noch den an einen warmen Dachraum zu stellenden Anforderungen genügt. Bei ersterem sind ‒ anders als im vorliegenden Fall ‒ gerade keine Zwischensparrendämmung im Dach und keine Dampfbremse zwischen Dachraum und Dachkonstruktion vorgesehen und für letzteren fehlt es an der zumindest bei gedämmten, jedoch ungeheizten und daher schadensträchtigen Spitzböden erforderlichen Belüftung der Dachkonstruktion. Dies hat der Kläger unter Bezugnahme auf das im selbständigen Beweisverfahren eingeholte Gutachten des Sachverständigen X. vom 31.05.2021 im Einzelnen dargelegt (Bl. 15 f. LGA) und der Beklagte ist dem nicht hinreichend entgegengetreten.
38
Sein Vortrag in der Klageerwiderung, es liege kein Mangel der Ausführungsplanung, insbesondere im Plan Nr. N02 vom 10.10.2013 vor (Bl. 157 LGA), zwischen dem 1.OG und dem Spitzboden sei eine Dämmung geplant und ausgeführt, dieser sei also gerade von den Wohnräumen abgegrenzt worden, und die Planung einer Zwischensparrendämmung im Dach und einer Dampfbremse zwischen Dachraum und Dachkonstruktion sei auch in dieser Kombination kein Mangel, weil diese Planung nicht bereits regelwidrig sei (Bl. 158 LGA), genügt dazu nicht. Denn dieser geht weder auf den Aspekt ein, dass der geplante Spitzboden wegen der Zwischensparrendämmung und der Dampfbremse zwischen Dachraum und Dachkonstruktion eben nicht kalt, sondern warm war, noch auf das Fehlen der bei diesem Anwendungsfall eines „warmen“ Dachraumes erforderlichen Belüftung. Warum die von ihm geplante Dachkonstruktion dennoch und trotz des Umstandes, dass die vom Kläger zitierten technischen Regelwerke einen Dachaufbau in der von ihm ausgeführten Art nicht kennen, regelgerecht sein sollte, hat der fachkundige Beklagte nicht dargelegt. Darauf, dass sein Vortrag insoweit nicht hinreichend substantiiert ist, hat ihn das Landgericht mit dem angefochtenen Urteil auch hingewiesen. Dennoch trägt der Beklagte zu der Thematik „Planungsfehler“ auch in der Berufungsbegründung nicht näher vor. Einer Beweisaufnahme darüber bedarf es daher nicht.
39
Auch über das Vorliegen eines Überwachungsfehlers muss im vorliegenden Fall kein Beweis erhoben werden. Das Landgericht ist insoweit zu Recht davon ausgegangen, dass hier wegen der am Dach vorhandenen Baumängel der erste Anschein dafür spricht, dass der Beklagte einen Bauüberwachungsfehler begangen hat, und dass der Beklagte diesen Anscheinsbeweis nicht durch substantiiertes Vorbringen entkräftet hat. Zwar kann der Beweis des ersten Anscheins in Bezug auf einen Bauüberwachungsfehler nur bei Mängeln an Arbeiten angenommen werden, die in jedem Fall einer umfangreichen Bauaufsicht des Architekten bedürfen. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, war das bei den hier streitgegenständlichen Dachdeckerarbeiten, die u.a. die Ausführung von Dampfsperrbahnen und einer Wärmedämmung beinhalteten, aber der Fall, weil es sich dabei um schwierige bzw. gefahrträchtige Arbeiten handelte. Jedenfalls dass beide Dampfbremsen an unverputztes Mauerwerk angeschlossen waren, dass die untere Dampfbremse nicht abgedichtete Durchdringungen durch Rohre und Kabel aufwies (Bl. 14 LGA), dass die Dachschalung bereits beim Einbau partiell feucht war (Bl. 17 LGA) und dass die eingebrachten Dampfbremsen nicht den erforderlichen bauaufsichtlichen Verwendungsnachweis besaßen, wäre bei der gebotenen Überwachung der Dachdeckerarbeiten durch den Beklagten für diesen ohne weiteres erkennbar gewesen.
40
Demgegenüber kann er sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass seine Mitarbeiterin, die Zeugin L., den Einbau der Dichtheitsschicht überwacht habe (Bl. 159 LGA). Abgesehen davon, dass dieser Einbau ohnehin nur einen Teil der Dachdeckerarbeiten ausmachte, hätte es insofern auch detaillierten Vortrags dazu bedurft, was genau die Zeugin L. denn insoweit geprüft hat. Wie sie laut dem Vortrag in der Klageerwiderung festgestellt haben soll, dass die Luftundichtigkeiten, die der Kläger auf S. 10 unter lit. a) der Klageschrift benannt hat, zum Zeitpunkt der Einbringung der Dichtheitsschicht zwischen Obergeschoss und Spitzboden nicht vorhanden waren (Bl. 159 LGA), erschließt sich nicht. Soweit der Beklagte pauschal behauptet, wenn es hier weiterhin zu Durchlässigkeiten komme, seien diese auf Materialbeschädigungen zurückzuführen, die nicht im Rahmen der Überwachung erkennbar gewesen seien (Bl. 159 LGA), setzt er sich weder mit den vom Kläger in Bezug genommenen Fotos auseinander, noch legt er dar, was hier wann und wie beschädigt worden sein soll. Auch in Bezug auf das Vorliegen eines Überwachungsfehlers ist der Beklagte bereits durch das landgerichtliche Urteil auf die fehlende Substanz seines Vortrags hingewiesen worden, ohne dass er dem in der Berufungsbegründung Rechnung getragen hätte.
41
Soweit der Beklagte meint, auch das Thema „feuchtevariable Dampfbremse“ führe nicht zu einem Mangel, und dazu ausführt, dass zum Zeitpunkt des ‒ von der Zeugin L. überwachten ‒ Einbaus kein erhöhtes Raumklima vorgeherrschte habe (Bl. 159f LGA) bzw. er die Umstände für den fachgerechten Einbau der feuchtevariablen Dampfbremse kontrolliert und überwacht habe, die am Tag des Einbaus gegeben gewesen seien (Bl. 232 LGA), übersieht er, dass bereits der Einbau einer feuchtevariablen Dampfbremse ohne den erforderlichen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis einen Mangel verursachte. Auf die Frage, ob während des Einbaus eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Gebäude herrschte, die der Beklagte bzw. die Zeugin L. hätte begrenzen müssen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit über die feuchtevariable Dampfbremse in die Dachkonstruktion zu verhindern, kommt es im Ergebnis auch nicht an, weil der Sachverständige diese Pflichtverletzung ohnehin nicht für eine erwiesene, sondern nur für eine sehr wahrscheinliche Schadensursache gehalten hat (Bl. 113 LGA) und sich der Beklagte von den anderen oben dargelegten Pflichtverletzungen nicht entlastet hat.
42
Dass der Beklagte letztere zu vertreten hat, wird gemäß § 280 Abs. 1 S. 2 BGB vermutet.
43
Durch diese Pflichtverletzungen ist dem Kläger auch ein Schaden entstanden, weil sich die Planungs-und Überwachungsfehler des Beklagten im Dach seines Bauwerks bereits in Form von Mängeln verwirklicht haben und der Kläger die zu deren Beseitigung erforderlichen Kosten vorfinanzieren muss. Daher kann er den entsprechenden Betrag als Vorschuss vom Beklagten verlangen.
44
Dieser Vorschuss muss jedenfalls die Kosten abdecken, die durch die Änderung der fehlerhaft geplanten Dachkonstruktion in eine regelgerechte Dachkonstruktion anfallen werden, sowie die Kosten, die für den Austausch der Dampfbremsen ohne bauaufsichtlichen Verwendungsnachweis und der bereits beim Einbau feuchten Teile der Dachschalung entstehen werden. Denn diese Kosten wären nicht entstanden, wenn der Beklagte die Dachkonstruktion ordnungsgemäß geplant und deren Ausführung ordnungsgemäß überwacht hätte. Darüber hinaus muss der Vorschuss aber auch solche Kosten umfassen, die für die Beseitigung von Schäden am Dach anfallen werden, die erst infolge der nicht regelgerechten Dachkonstruktion, der nicht luftdicht angeschlossenen Dampfbremsen und der partiell feuchten Teile der Dachschalung entstanden sind.
45
Der Kläger hat die Kosten für die Schadensbeseitigung und mangelfreie Herstellung eines warmen Dachraums unter Berufung auf die Ermittlung des Gerichtssachverständigen X. mit 224.036,54 EUR Baukosten und 34.272,00 EUR Planungskosten, mithin in Summe 258.308,54 EUR beziffert und das Landgericht hat gemeint, der sachkundige Beklagte sei diesem substantiierten Vortrag zur Erforderlichkeit und Angemessenheit der Kosten trotz Hinweises der Gegenseite nicht hinreichend substantiiert entgegengetreten.
46
Der Beklagte hat allerdings auf S. 4 oben der Klageerwiderung vorgetragen, die Ausführungsplanung habe nicht zu einem Mangel bzw. Schaden geführt, sondern warme feuchte Luft habe allenfalls durch die Luftdichtheitsebene gelangen können; der Gerichtsgutachter habe bis jetzt nicht feststellen können, dass für die monierten Schäden die Ausführungsplanung ursächlich gewesen sei. Außerdem hat der Beklagte auf S. 5 der Klageerwiderung unter der Überschrift „4. Zur Schadenshöhe“ nicht nur die Ursächlichkeit seiner konkreten Ausführungsplanung sowie die Ursächlichkeit von bestrittenen Überwachungsfehlern für den unter 7.f) behaupteten Schaden bestritten, sondern auch erklärt, weiterer Vortrag zu den behaupteten Mängeln bzw. zu der Beweissituation folge, sobald auf die Ergänzungsfragen im Beweisverfahren eingegangen worden sei.
47
Damit hat der Beklagte zum Ausdruck gebracht, dass er die Schadenshöhe im Einzelnen bestreiten will und dies Gegenstand seiner Ergänzungsfragen im selbständigen Beweisverfahren ist. Mit Blick darauf, dass der Kläger bereits zuvor die Hinzuziehung der Akte LG Köln, AZ: 8 OH 7/20, mithin des selbständigen Beweisverfahrens beantragt hatte, er deren Inhalt also kannte und dieses Verfahren von derselben Kammer bearbeitet wurde, die mit dem hiesigen Hauptsacheverfahren befasst war, ist fraglich, ob der Beklagte diese Ergänzungsfragen im Hauptsacheverfahren noch einmal wiederholen musste oder ob nicht bereits die (konkludente) Bezugnahme auf diese allen Beteiligten bekannten Fragen ausreichte. Auch wenn man letzteres mit dem Landgericht verneint, hätte dieses den Beklagten aber jedenfalls darauf hinweisen müssen, dass es seinen Vortrag insoweit für nicht hinreichend substantiiert hielt und deshalb unabhängig von dem Inhalt seiner Ergänzungsfragen und deren noch ausstehender Beantwortung zu entscheiden beabsichtigte. Damit hat es das Recht des Beklagten auf rechtliches Gehör verletzt.
48
Das angefochtene Urteil beruhte auch auf diesem Gehörsverstoß. Denn es war nicht auszuschließen, dass die Entscheidung des Landgerichts anders ausgefallen wäre, wenn der Beklagte Gelegenheit gehabt hätte, diesem den Inhalt der nun in der Berufungsbegründung aufgeführten Ergänzungsfragen mitzuteilen. Wenn der Beklagte mit seinem Bestreiten der Schadenshöhe Erfolg gehabt hätte, hätte das Landgericht den Vorschussanspruch nämlich nicht bzw. nicht in der zuerkannten Höhe von 258.308,54 € ohne Beweisaufnahme zusprechen dürfen.
49
Nach dem Ergebnis der zwischenzeitlich vom Senat durchgeführten Beweisaufnahme steht allerdings fest, dass ein Vorschuss in mindestens dieser Höhe erforderlich ist, um den Aufwand für die Schadensbeseitigung und mangelfreie Herstellung eines warmen Dachraums abzudecken, so dass sich das erstinstanzliche Urteil im Ergebnis nach Beweisaufnahme dennoch als richtig erweist.
50
Der Sachverständige X. hat festgestellt, dass zur mängelfreien Erstellung der Dachkonstruktion deren Rückbau und Neuerrichtung erforderlich sind, und geschätzt, dass dafür Baukosten i.H.v. 224.036,54 € und Planungskosten i.H.v. 34.272,00 € anfallen werden. Er hat mittlerweile sämtliche in der Berufungsbegründung wiedergegebenen Fragen des Beklagten zu seinem Hauptgutachten, nämlich
51
- aufgrund welcher fehlerhaft durchgeführten Planungs- oder Überwachungsleistung des Antragsgegners die geborgenen Schiefernägel korrodiert seien und ob dadurch deren Funktion unbrauchbar geworden sei,
52
- ob der vorgefundene Besatz mit Schimmelpilz das Holz oder andere am Dach eingesetzte Materialien beeinträchtige oder gar zerstören könne,
53
- ob die zu c) im Gutachten betrachteten Baustoffe aus Holz für den weiteren Einsatz innerhalb der Konstruktion unbrauchbar bzw. gesundheitsschädigend seien,
54
- wo und wie im Einzelnen die nicht luftdichten Klebeverbindungen dazu führen würden, dass eine negative Abweichung zum Vertragssoll entstehe,
55
- ob die bemängelten Anschlussstellen der Dampfsperre auch nachträglich noch abgedichtet werden könnten und welche Auswirkung das dann auf die unter a) bis g) aufgeführten Erscheinungen haben werde,
56
- ob er ausschließen könne, dass die Schäden an der straßenseitigen Giebeltympanie durch Feuchtigkeitseintrag der Bauteilöffnung entstanden seien und ob er wisse, seit wann diese Bauteilöffnungen bestanden hätten,
57
- wie sich die von ihm bemängelten Luftundichtigkeiten von Innen nach Außen diesbezüglich auswirken würden sowie welcher Dämmwert für die Dachflächen notwendig gewesen wäre, damit von einem Kaltraum die Rede sei, sowie
58
- welche Vor- und Nachteile der warme Dachraum gegenüber der Nachbesserungsmöglichkeit des kalten Dachraums habe und wie sich die Kosten hierzu verhalten würden,
59
gut nachvollziehbar und überzeugend beantwortet. Wegen des Inhalts der Antworten wird auf das 2. Ergänzungsgutachten des Sachverständigen vom 07.09.2022, dort S. 13 bis 18 (Bl. 698 bis 703 BA) Bezug genommen.
60
In diesem Ergänzungsgutachten hat der Sachverständige auch ‒ wie vom Beklagten gefordert ‒ nochmals Stellung zu den Mangelursachen genommen und begründet, warum alles ausgetauscht und saniert werden musste. Hierzu hat er zum einen erklärt, dass es auch nach nochmaliger inhaltlicher Auseinandersetzung mit der Thematik bei den Antworten aus dem Gutachten vom 31.05.2021 bleibe (S. 16 des 2. Ergänzungsgutachtens, Bl. 701 BA), und zum anderen ausgeführt, dass die Schieferstifte korrodiert seien, die Dachschalung schimmelpilzbefallen sei, die Dachsparren zumindest teilweise schimmelpilzbefallen seien, die Wärmedämmung zumindest in Teilbereichen mit Pilzsporen belegt sei, die Verklebung der Dampfbremse(n) fehlerhaft sei, das Giebelmauerwerk unverputzt sei, die Dachkonstruktion insgesamt fehlerhaft geplant sei und umgebaut werden müsse, die eingebaute feuchtevariable Dampfbremse über keinen bautechnischen Verwendbarkeitsnachweis verfüge und gar nicht hätte eingebaut werden dürfen, die Dampfbremse unter dem OSB-Boden des Spitzbodens Fehlstellen aufweise, die außenliegenden Gesimse aus Holzwerkstoffen pilz-und schimmelpilzbefallen seien und dass all das Vorgenannte in Summe die Maßnahmen und Kosten aus dem Gutachten vom 31.05.2021 ab Seite 44 begründe (S. 17 des 2. Ergänzungsgutachtens, Bl. 702 BA).
61
Soweit der Beklagte außerdem gefordert hat, der Sachverständige solle seine Hypothese zur Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion im Zusammenhang mit der feuchtevariablen Dampfbremse anhand der von ihm vorgelegten Dokumentation des Bauablaufs prüfen, hat der Sachverständige zu Recht darauf hingewiesen, dass ihm keine entsprechenden Dokumentationen vorlägen und auch keine in der Akte hätten erkannt werden können (S. 16 des Ergänzungsgutachtens, Bl. 701 BA).
62
Der Senat verkennt nicht, dass der Beklagte im selbständigen Beweisverfahren mit Schriftsatz vom 05.07.2023 (Bl. 757 ff. BA) noch weitere Ergänzungsfragen gestellt hat. Insofern bedarf es aber keiner weiteren Begutachtung mehr, weil sich die Antworten auf diese Fragen entweder bereits aus den schon vorliegenden Ausführungen des Sachverständigen ergeben oder sie nicht entscheidungserheblich sind. Im Einzelnen:
63
Die Frage des Beklagten, wie er davon ausgehen könne, dass unter jeder einzelnen Dachfläche dieselbe erhöhte Feuchtigkeit, insbesondere stark korrodierte Schiefernägel aufgrund mangelhafter Planung und Überwachung vorzufinden seien und ob er ausschließen könne, dass die anderen Dachflächen (als die untersuchte) nicht sanierungsbedürftig seien, ist für die Entscheidung des hiesigen Rechtsstreits ohne Belang. Denn die Schiefernägel müssen jedenfalls deshalb erneuert werden, weil die Dachkonstruktion vom Beklagten insgesamt fehlerhaft geplant worden ist und deshalb umgebaut werden muss. Die Errichtung des vertraglich geschuldeten warmen Dachraums erfordert nämlich bereits ausweislich des Hauptgutachtens des Sachverständigen einen Rückbau der Schiefereindeckung (vgl. S. 44 des Hauptgutachtens, Bl. 162 BA). Dieser wiederum ist bereits denknotwendig nicht ohne eine Entfernung der Schiefernägel möglich, wobei letztere zwangsläufig beschädigt werden können, so dass eine uneingeschränkte Weiterverwendung dieser Nägel selbst dann nicht in Betracht kommt, wenn sie nicht korrodiert sein sollten.
64
Es ist auch nicht nötig, den Sachverständigen dazu zu befragen, ob er ausschließen könne, dass der (auf der Dachschalung) vorgefundene Schimmelpilzbesatz noch nicht abgestorben und damit zerstörend sei. Dass die Antwort auf diese Frage „nein“ lautet, ergibt sich nämlich bereits aus dem Laborbericht der BMA-Labor GbR vom 29.03.2021, in dem es auf S. 2 (Bl. 171 BA) heißt: „… Mit dieser Methode kann jedoch nicht bestimmt werden, ob die Schimmelpilzart noch kultivierbar oder schon abgestorben ist“. Dass der Sachverständige diesen Laborbericht bei seinen Feststellungen berücksichtigt hat, folgt daraus, dass er ihn dem Hauptgutachten als Anlage beigefügt hat.
65
Die Frage, ob dem Sachverständigen eine verifizierbare und nachprüfbare Messung zur Verfügung stehe, wonach die Dachkonstruktion unter sämtlichen Dachflächen des Gebäudes bereits dermaßen geschädigt sei, dass diese ersetzt werden müsse, bedarf ebenfalls keiner (nochmaligen) Beantwortung, weil sie schon geklärt ist. Hierzu hat der Sachverständige nämlich bereits in seinem Hauptgutachten ausgeführt, dass im Rahmen einer Ortsbesichtigung nicht die gesamte Konstruktion zurückgebaut und freigelegt werden könne und sich daher auf die Erkenntnisse der Bauteilöffnungen berufen werde (S. 43 des Hauptgutachtens, Bl. 161 BA). Selbstverständlich kann und muss der Sachverständige für die Ermittlung eines Kostenvorschusses nicht die gesamte Dachkonstruktion zerstörend untersuchen; die Beprobung einer aussagekräftigen Anzahl von Stellen ist ausreichend. Das ist hier durch den Sachverständigen erfolgt. Eine derart detaillierte Tatsachenfeststellung, wie sie der Beklagte fordert, ist insbesondere in einem Vorschussprozess nicht erforderlich.
66
Die vom Beklagten im Zusammenhang mit den Luftundichtigkeiten zwischen dem Spitzboden und dem Außenbereich gestellte Ergänzungsfrage, ob der Sachverständige ausschließen könne, dass ursprünglich überwachte luftdichte Klebeverbindungen sich später wieder lösen könnten, ist für die Entscheidung des Rechtsstreits ebenfalls ohne Belang. Auch wenn man zugunsten des Beklagten unterstellen würde, dass der Sachverständige dies nicht ausschließen kann, und deshalb insoweit ein Überwachungsfehler zu verneinen wäre, müsste die Dampfbremse zwischen dem Spitzboden und dem Außenbereich nämlich jedenfalls deshalb ersetzt ‒ und dann natürlich auch ordnungsgemäß verklebt ‒ werden, weil sie nicht den erforderlichen bauaufsichtlichen Verwendungsnachweis besitzt (vgl. S. 40 des Hauptgutachtens, Bl. 158 BA) und weil das Dach ohnehin umgebaut werden muss, um die vom Sachverständigen X. festgestellte „grundlegende konzeptionelle Fehlplanung“ (S. 38 des Hauptgutachtens, Bl. 156 BA) zu beseitigen. Dieser Umbau beinhaltet zwangsläufig einen Austausch der Dampfbremse, weil er u.a. den Rückbau der Dämmung in der Dachschräge umfasst (vgl. S. 44 des Hauptgutachtens, Bl. 162 BA), der wiederum nur erfolgen kann, wenn man zuvor die vorhandene Dampfbremse, die sich unterhalb dieser Dämmung befindet (vgl. Traufdetail/Dachaufbau S. 40 des Hauptgutachtens, Bl. 158 BA), entfernt und sie nach Erstellung einer neuen Zwischensparrendämmung neu errichtet (vgl. S. 46 des Hauptgutachtens, Bl. 164 LGA).
67
Mit einer entsprechenden Begründung ist auch die die Luftundichtigkeiten zwischen Obergeschoss und Spitzboden betreffende Ergänzungsfrage, ob, wenn alle fehlerhaften Anschlussstellen wieder ordnungsgemäß verschlossen würden und vorher eine Trocknung des Zwischenraumes durchgeführt werde, die Schadensursächlichkeit behoben werden könne, zu verneinen. Denn auch die dortige Dampfbremse müsste jedenfalls deshalb ersetzt werden, weil sie nicht den erforderlichen bauaufsichtlichen Verwendungsnachweis besitzt.
68
Soweit der Beklagte außerdem wissen möchte, warum die von ihm erwähnte Sanierungsmöglichkeit, die Decke nicht zu öffnen und die Luftdichtheitsebene ins Dachgeschoss zu verschieben, ausgeschlossen werde, ergibt sich die Antwort bereits aus dem Vorstehenden. Abgesehen davon ist auch nicht ersichtlich, wie der Beklagte es bewerkstelligen will, die Luftdichtheitsebene ohne eine Öffnung der Decke zu verschieben. Denn dafür wäre eine Entfernung der Dampfbremse zwischen Obergeschoss und Spitzboden erforderlich. Da sich diese unterhalb der OSB-Schalung befindet (vgl. Traufdetail/Dachaufbau S. 40 des Hauptgutachtens, Bl. 158 BA), müsste man aber zwangsläufig den vom Beklagten als „Decke“ bezeichneten Boden des Spitzbodens öffnen, um sie zu entfernen.
69
Der Senat muss den Sachverständigen im Zusammenhang mit der Pilzbildung im Bereich der profilierten Gesimse auch nicht fragen, ob er den Bericht des BZR-Institutes, auf den er sich stütze, auf Plausibilität geprüft habe und ob er zwangsläufig seine Annahme auch auf die restliche Dachkonstruktion, die nicht geöffnet worden sei, übertrage. Denn auch darauf kommt es für die Entscheidung des Rechtsstreits nicht an. Bereits in seinem Hauptgutachten hat der Sachverständige (dort auf S. 29 f, Bl. 147 BA) dargelegt, dass es über nicht luftdichte Anschlüsse der Dampfbremse an das unverputzte Mauerwerk sowie durch unvermörtelte Stoßfugen des Mauerwerks infolge des Dampfdruckgefälles dazu komme, dass warme, mit Feuchtigkeit angereicherte Raumluft aus dem Spitzbodenbereich durch das Mauerwerk bis in die Gesimskästen ströme, sich auf diesem Weg nach außen abkühle und es dann dort zu Tauwasserausfall komme, der wiederum Bauschäden wie Fäulnis und Schimmelpilzbildung, aber auch abplatzende Farbe, zur Folge haben könne. Den Bericht des BZR-Instituts hat er in seinem 2. Ergänzungsgutachten (dort auf S. 16, Bl. 701 BA) lediglich erwähnt, um zu erklären, warum er einen Zusammenhang der Schäden an der straßenseitigen Giebeltympanie mit nachträglicher, erst durch die Bauteilöffnungen des Privatsachverständigen eingetragener Feuchtigkeit von außen ausschließt. Dieser Begründung hätte es aber gar nicht bedurft, weil zwischen den Parteien unstreitig war und ist, dass der Kläger bereits im Mai 2018 Feuchtigkeitsschäden an der Dachuntersicht gerügt hatte und dass die Mitarbeiterin des Beklagten ihm im Mai 2019 eine Tabelle übersandt hatte, aus der sich das Vorhandensein solcher Feuchtigkeitsschäden ergab (vgl. Anlage K3, Bl. 26 f. LGA). Daher stand schon deshalb fest, dass die erst mehrere Monate später, nämlich erst am 04.10.2019 erfolgten Bauteilöffnungen durch den Privatsachverständigen hier nicht schadensursächlich gewesen sein können.
70
Entgegen der Ansicht des Beklagten hat der Sachverständige seine (Kern-)Frage, warum alles ausgetauscht und saniert werden müsse, in seinem 2. Ergänzungsgutachten bereits beantwortet. Wie oben dargelegt, hat er dazu nämlich erklärt, dass die Summe aller von ihm im Einzelnen genannten Schäden die Maßnahmen und Kosten aus dem Gutachten vom 31.05.2021 ab Seite 44 begründe. Angesichts dessen erübrigt es sich, den Sachverständigen, wie vom Beklagten beantragt, zu fragen, warum er davon ausgehe, dass die gesamte Dachkonstruktion feucht und befallen sei und ausgetauscht werden müsse. Denn der Sachverständige hat damit bereits dargelegt, weshalb er meint, dass die gesamte Dachkonstruktion ausgetauscht werden muss. Ob er ‒ wie der Beklagte unterstellt ‒ außerdem davon ausgeht, dass die gesamte Dachkonstruktion feucht und befallen ist, kann dahinstehen. Deren Erneuerung ist nämlich jedenfalls deshalb erforderlich, weil die Dachkonstruktion infolge der fehlerhaften Planung und wegen der ungeeigneten Dampfbremsen komplett umgebaut werden muss.
71
Zwar mag es Teile dieser Konstruktion geben, die weder von Feuchtigkeit noch von Schimmel befallen sind und die deshalb nach dem Rückbau des Daches bei dessen fachgerechter Neuerrichtung wiederverwendet werden können. Hinreichend sicher ist das aber nicht. Denn zum einen konnte sich die Feuchtigkeit im Dachstuhl dort mittlerweile über einen Zeitraum von acht Jahren hinweg ungehindert ausbreiten und zum anderen setzt eine Wiederverwendung von Teilen der Dachkonstruktion voraus, dass diese bei den noch vorzunehmenden Abrissarbeiten nicht beschädigt werden. Ob und in welchem Umfang weder durch die Feuchtigkeit noch durch die Abrissarbeiten beeinträchtigte Bauteile vorhanden sein werden, lässt sich derzeit nicht beurteilen, sondern wird sich erst im Zuge der Schadensbeseitigung zeigen. Daher ist der Sachverständige bei der Schätzung der für letztere voraussichtlich erforderlichen Kosten zu Recht davon ausgegangen, dass alle Materialien erneuert werden müssen. Sollte sich im Laufe der Arbeiten herausstellen, dass das tatsächlich nicht der Fall ist, kann (und muss) diesem Umstand bei der anschließend vom Kläger vorzunehmenden Abrechnung über den Vorschuss Rechnung getragen werden.
72
Im Anschluss an die Ausführungen des Sachverständigen schätzt der Senat den Schaden des Klägers hier auf mindestens 258.308,54 €. Zwar ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Kosten für die stärkere Dämmung des Spitzbodens um Sowiesokosten handelt, um die der Anspruch an sich gekürzt werden müsste, weil sie dem Kläger auch bei mangelfreier Vertragsdurchführung entstanden wären. In Anbetracht dessen, dass der Sachverständige die Kosten für die gesamte Dämmung des Spitzbodens (also für die Unterdeckplatte, die Schubbohle, die Konterlatte, die Zwischensparrendämmung nach EnEv-Standard, die Dampfbremse und die Stützlattung) im 2 Ergänzungsgutachten lediglich mit rund 21.500,00 € netto, mithin 25.585,00 € brutto beziffert hat (dort auf S. 18, Bl. 703 BA) und dieser Betrag nicht einmal 10 % der Gesamtkosten ausmacht, während die seit der Erstellung der Kostenschätzung im Mai 2021 eingetretene Baukostensteigerung bekanntermaßen weit darüber liegt, sieht der Senat aber keinen Anlass für eine Herabsetzung des Vorschussbetrages.
73
Mit seinem Einwand, das Urteil des Landgerichts sei rechtsfehlerhaft, weil es ein anspruchsverkürzendes Mitverschulden seitens des Klägers hätte annehmen müssen, dringt der Beklagte ebenfalls nicht durch. Richtig ist zwar, dass das Landgericht den Vortrag des Beklagten in der Klageerwiderung auf S. 4 unten nicht beachtet hat, zwischen den Parteien sei im Rahmen der Ausführungsplanung besprochen und darauf hingewiesen worden, dass das Dach regelmäßig gewartet werden müsse, hierzu sei dem Kläger aufgegeben worden, Wartungsverträge zu schließen, und im Rahmen dieser Wartungen hätte kontrolliert werden müssen, ob die feuchtevariable Dampfbremse hier konkret ordnungsgemäß arbeite (Bl. 159 LGA). Es stimmt auch, dass der Kläger diesen Vortrag in erster Instanz nicht bestritten hat. Der Kläger weist allerdings in seiner Berufungserwiderung zutreffend darauf hin, dass der Beklagte schon nicht behauptet, dass er ihn auf die Notwendigkeit einer solchen Wartung, konkret mit dem Inhalt der Kontrolle der Funktion der feuchtevariablen Dampfsperre hingewiesen habe, sondern dass der Beklagte lediglich meine, dass die Funktionskontrolle bei einer Wartung des Daches dazugehören müsse. Auch die weitere (hier nur sinngemäß wiedergegebene) Argumentation des Klägers, es sei nicht ersichtlich, woraus sich ein solcher Wartungsinhalt ergebe, woher er dies hätte wissen sollen/müssen, wann er eine Wartung versäumt habe, was er im Zuge der Wartung konkret hätte feststellen sollen und wie sich die fehlende Feststellung schadenserhöhend ausgewirkt habe, trifft im Wesentlichen zu. Dem Vorbringen des Beklagten lässt sich nämlich nur entnehmen, dass der Kläger im Zuge der Wartung Feuchtigkeit hätte feststellen sollen.
74
Soweit der Beklagte dazu in der Berufungsbegründung vorträgt, Inhalt der Wartungsverträge habe sein sollen, die Funktion der feuchtevariablen Dampfbremse regelmäßig zu kontrollieren, diesen Wartungsvertrag habe der Kläger nicht abgeschlossen, denn sonst wäre die Feuchtigkeit aufgefallen, stellt sich die Frage, welche Feuchtigkeit bei einer regelmäßigen Kontrolle der Funktion der feuchtevariablen Dampfbremse wo und wie hätte auffallen sollen. Dass im Spitzboden, wo diese Dampfbremse verbaut war, sichtbare Feuchtigkeitserscheinungen vorhanden gewesen seien, hat nämlich keine der Parteien behauptet. Vielmehr hat die Zeugin L. dem Kläger noch zu einem Zeitpunkt, an dem sich außen an der Dachuntersicht schon Feuchtigkeitsschäden zeigten, mitgeteilt, dass an seinem Dach bei einer Öffnung der Konstruktion kein Fehler in dieser habe festgestellt werden können, dass die Dachhaut laut der Firma P. keine Schäden aufgewiesen habe, dass ein ihrerseits geöffnetes Brett im Bereich des Balkons seiner Tochter trocken gewesen sei und dass auch die drei Bereiche, die sie im Spitzboden geöffnet hätten, trocken gewesen seien (E-Mail vom 28.11.2018, Anlage K2, Bl. 23 LGA). Wie ein mit der Wartung der feuchtevariablen Dampfbremse beauftragter Handwerker dann sogar ohne eine Bauteilöffnung Feuchtigkeit hätte feststellen sollen, erschließt sich nicht.
75
Wie das Landgericht zutreffend erkannt hat, stehen dem Kläger auch die übrigen mit der Klage geltend gemachten Ansprüche gegen den Beklagten zu.
76
Die Kostenentscheidung beruht, was die Zurückweisung der Berufung anbelangt, auf § 97 Abs. 1 ZPO. Soweit dem Beklagten die Kosten des selbständigen Beweisverfahrens und den dortigen Nebenintervenienten die Kosten der Nebenintervention auferlegt worden sind, ergibt sie sich aus §§ 91 Abs. 1. S. 1, 101 Abs. 1 ZPO.
77
Die Kosten eines vorausgegangenen selbständigen Beweisverfahrens gehören auch dann zu den Kosten des Hauptsacheverfahrens, wenn dessen Streitgegenstand und der Gegenstand des selbständigen Beweisverfahrens nur teilweise identisch sind (BGH, Beschluss vom 10. Januar 2007 ‒ XII ZB 231/05 ‒, juris). War der Untersuchungsstoff des Beweisverfahrens Gegenstand mehrerer Hauptsacheprozesse, so sind die Kosten des Beweisverfahrens nach dem Verhältnis der Einzelstreitwerte anteilig umzulegen (MüKoZPO/Schulz, 6. Aufl. 2020, ZPO § 91 Rn. 29 m.w.N.).
78
Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Das selbständige Beweisverfahren betraf neben den hier streitgegenständlichen Mängeln und Mangelfolgeschäden weitere Mängel und Mangelfolgeschäden, die Gegenstand eines anderen Hauptsacheprozesses, nämlich des Verfahrens LG Köln, 8 O 41/23 waren. Die Einzelstreitwerte des selbständigen Beweisverfahrens sind aus Sicht des Senats wie vom dortigen Antragstellervertreter angegeben mit 258.308,00 € für die im vorliegenden Prozess geltend gemachten Schäden und mit rund 236.000,00 € für die übrigen, hier nicht streitgegenständlichen Schäden zu bemessen. Da der Beklagte im hiesigen Prozess voll unterliegt und der auf die hier streitgegenständlichen Mängel und Mangelfolgeschäden entfallende Einzelstreitwert 52 % des Gesamtstreitwerts des selbständigen Beweisverfahrens ausmacht, waren dem Beklagten die Kosten des selbständigen Beweisverfahrens also in Höhe von 52 % (258.308,00 € : 494.308,00 € x 100 = 52,26 %) aufzuerlegen. Da dem selbständigen Beweisverfahren zwei Nebenintervenienten auf Seiten des Beklagten beigetreten waren, war außerdem gemäß § 101 Abs. 1 ZPO auszusprechen, dass diese 52 % der Kosten ihrer Nebenintervention selbst tragen. Über die übrigen Kosten des selbständigen Beweisverfahrens und der dortigen Nebenintervention konnte der Senat nicht entscheiden, weil der Streitgegenstand des hiesigen Hauptsacheprozesses und der Gegenstand des selbständigen Beweisverfahrens insoweit nicht übereinstimmen.
79
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
80
Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision gemäß § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Weder hat die Sache grundsätzliche Bedeutung noch ist eine Entscheidung des Revisionsgerichts zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich.
Tenor:
Die Kosten des Berufungsverfahrens und 52 % der Kosten des selbständigen Beweisverfahrens LG Köln, 8 OH 7/20 werden dem Beklagten auferlegt. Von den Kosten der dortigen Nebenintervention tragen die Nebenintervenienten 52 % selbst.
Dieses und das angefochtene Urteil sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger zuvor Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf bis 280.000,00 € festgesetzt.
1
Gründe:
2
I.
3
Der Kläger begehrt von dem beklagten Architekten Kostenvorschuss und Schadensersatz wegen Mängeln an der Dachkonstruktion des klägerischen Bauvorhabens.
4
Das Baugrundstück stand ursprünglich im Eigentum einer aus dem Kläger und dessen Schwester bestehenden Erbengemeinschaft. Die Geschwister beauftragten den Beklagten in Bauherrengemeinschaft mit der Vollarchitektur, mit Ausnahme von Leistungsphase 9 nach HOAI, für den Neubau einer Unternehmervilla („Villa C.") O.-straße N03, N01 Z. T., auf Basis des schriftlichen Architektenvertrags vom 23.08.2011 (Anlage RSNP1, Bl. 219 ff. LGA).
5
Später verständigten sich die Geschwister darauf, dass der Kläger seiner Schwester ihren hälftigen Anteil an dem Baugrundstück abkaufen und das Bauvorhaben alleine fortführen solle. Unter dem 11.01.2013 erfolgte eine entsprechende Teil-Erbauseinandersetzung, mit der der Kläger das Baugrundstück zum Alleineigentum und Alleinbesitz erwarb. Danach übernahm er die Fortführung der Baumaßnahme als alleiniger Bauherr und Auftraggeber, womit der Beklagte einverstanden war und seine Tätigkeit für das streitgegenständliche Bauvorhaben nun ausschließlich für den Kläger erbrachte.
6
lm Zuge der Ausführungsplanung erstellte der Beklagte u.a. den Plan mit der Nr. N02 vom 10.10.2013, welcher die Detailplanung für die Errichtung eines Spitzbodens mit einer durchgehend ausgeführten Dampfbremse zwischen 1. OG und Spitzboden sowie zusätzlich zwischen Spitzboden und Dachkonstruktion sowie einer Dämmung zwischen Wohnraum und Spitzboden sowie zusätzlich einer Zwischensparrendämmung des Daches über dem Spitzboden beinhaltet (Anlage K1, Bl. 22 LGA).
7
Das Projekt wurde abgeschlossen und die Leistungen des Beklagten klägerseits abgenommen. Für seine Leistungen zahlte der Kläger an den Beklagten gem. der am 09.12.2016 übersandten Schlussrechnung insgesamt 358.646,77 € an Honorar.
8
Im Mai 2018 rügte der Kläger gegenüber dem Beklagten erstmalig Feuchtigkeitsschäden an der Dachuntersicht (außen). Nach Prüfung des gerügten Sachverhalts vor Ort durch eine Mitarbeiterin des Beklagten, die Zeugin L., gelangte die Beklagtenseite zu dem Schluss, dass keine Mängel vorlägen.
9
Hierauf schaltete der Kläger Rechtsanwalt B. aus der Kanzlei Dr. W. und Sozien GmbH ein, der mit Schreiben vom 11.06.2019 dem Beklagten eine Frist zur Mangelbeseitigung setzte. Der Beklagte wies mit E-Mail vom selben Tage eine etwaige Verantwortung zurück.
10
In der Folge konsultierte der Kläger den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Dachdeckerhandwerk G. H., der u.a. einen Blower-Door-Test bei gleichzeitiger Anwesenheit der Mitarbeiterin L. des Beklagten durchführte. Wegen der Ausführungen des Sachverständigen H. zu dem Ergebnis dieser Untersuchung wird auf seine E-Mail vom 24.09.2019 (Anlage K4, BI. 30 LGA) verwiesen. Am 04.10.2019 erfolgten Bauteilöffnungen und Probeentnahmen zwecks Überprüfung auf Schimmel- und Pilzbefall. Weiter entnahm der Sachverständige aus Anlass der Bauteilöffnungen auch Nägel aus der Schieferung und der Schalung. Es erfolgte sodann eine Untersuchung sowohl der Baustoffproben als auch der Nägel durch das Baustoffberatungszentrum (BZR) Rheinland, deren Ergebnisse dieses in seinem Prüfbericht/Gutachten vom 11.10.2019 aufführt. Wegen des Inhalts dieses Prüfberichts wird auf Anlage K6, BI. 52 ff LGA, verwiesen. Der Sachverständige H. stellte dem Kläger für seine Tätigkeit einschließlich der durch das Baustoffberatungszentrum (BZR) Rheinland entstandenen Kosten insgesamt 3.727,68 € in Rechnung.
11
Der Kläger ließ dem Beklagten mit Schreiben seiner jetzigen Prozessbevollmächtigten vom 25.11.2019 eine Frist zur Nachbesserung seiner Ausführungsplanung bzw. Erstellung einer Sanierungsplanung bis spätestens zum 15.01.2020 und eine weitere Frist zur Zahlung eines ersten Vorschusses von 50.000,00 € für die Mangelbeseitigung zzgl. Sachverständigen-, Labor- und Anwaltskosten bis spätestens zum 31.12.2019 setzen. Das vorgerichtliche Tätigwerden seiner jetzigen Prozessbevollmächtigten vergütete der Kläger mit 2.604,61 € brutto. Wegen des Vortrags der Klägerseite zur Höhe dieser Rechnung wird auf BI. 12 ff. LGA verwiesen.
12
Nachdem diese Fristen fruchtlos verstrichen waren, leitete der Kläger mit Antragsschrift vom 03.03.2020 das selbstständige Beweisverfahren zu Az. LG Köln 8 OH 7/20 ein. Der in diesem Verfahren bestellte Sachverständige X. erstattete dort im Hinblick auf den dortigen Beweisbeschluss vom 27.04.2020 sein Hauptgutachten vom 31.05.2021, welches der Kläger hier im Verfahren als Anlage K13 eingereicht hat. Wegen des näheren Inhalts dieses Gutachtens wird auf Anlage K13, Bl. 79 ff. LGA verwiesen.
13
Nach den Feststellungen des Sachverständigen X. sollen folgende, letztlich die gesamte Dachkonstruktion betreffende Zustände im Dachstuhl des Bauvorhabens vorliegen:
14
- korrodierte Nägel (Schieferstifte) der Dachdeckung aus Schiefer,
15
- Schimmelpilzbildung auf der Dachschalung, und zwar auf der Unterseite zur Dämmung zeigend, teilweise erhöhte Holzfeuchtigkeit im Bereich der Schalung und der Sparren
16
- Pilz- und Schimmelpilzbildung sowie durch zu hohe Untergrundfeuchtigkeit abblätternde Farbe im Bereich der profilierten Gesimse
17
- eine Vielzahl von Luftundichtigkeiten zwischen Spitzboden und Außen (Außenbereich)
18
- eine Vielzahl von Luftundichtigkeiten zwischen dem Obergeschoß und dem Spitzboden,
19
- Kondensatbildung/Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion.
20
Unter Bezugnahme auf die Ausführungen des Sachverständigen X. hat der Kläger behauptet, diese Erscheinungen seien auf Planungs- und Überwachungsfehler des Beklagten zurückzuführen, zu denen der Kläger näher vorgetragen und deren Vorhandensein sowie Schadenskausalität der Beklagte bestritten hat. Insbesondere hat der Kläger behauptet, die Undichtigkeiten seien darauf zurückzuführen, dass die Dampfsperre (Luftdichtigkeitsschicht) entgegen den allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) an unverputztes Mauerwerk angeschlossen worden sei, dass der Einsatz der hier verwendeten feuchtevariablen Dampfbremse zwischen dem Obergeschoss und dem Spitzboden (Dachstuhl) bei nicht fachgerechter Koordination mit den feuchtigkeitsträchtigen Arbeiten im Ober- und Erdgeschoss (Estrich- und Innenputzarbeiten) zu einer übermäßigen, fachwidrigen und schadensträchtigen Diffusion von Feuchtigkeit in den Dachstuhl führe und dass eine grundlegende konzeptionelle Fehlplanung und Ausführung seitens des Beklagten vorliege, mit der dieser die bauphysikalischen Verhältnisse regelwidrig und höchst schadensträchtig verändert habe.
21
Mit Blick darauf, dass der Sachverständige X. die Kosten für die Schadensbeseitigung und mangelfreie Herstellung eines warmen Dachraums mit 258.308,54 € beziffert hat, hat der Kläger diesen Betrag als schadensgleichen Kostenvorschuss vom Beklagten verlangt. Außerdem hat er von diesem Ersatz seiner vorgerichtlichen Rechtsanwalts-, Sachverständigen- und Laborkosten begehrt sowie die Feststellung der Ersatzpflicht des Beklagten für etwaige Folgeschäden.
22
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes bis zur Entscheidung in erster Instanz und der erstinstanzlich gestellten Anträge wird gemäß § 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen (Bl. 4 ff. OLGA).
23
Das Landgericht hat der Klage ohne Durchführung einer Beweisaufnahme vollumfänglich stattgegeben. Dies hat es im Wesentlichen wie folgt begründet: Das Architektenwerk des Beklagten sei mangelhaft, weil dessen Planung nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspreche. Er habe letztlich einen gedämmten, aber nicht beheizten Dachraum konstruiert, bei dem die Gefahr von Tauwasserbildung gegeben sei. Daher hätte er jedenfalls einen belüfteten Hohlraum über der durch die Unterdeckung abgegrenzten Ebene der Zwischensparrendämmung vorsehen müssen, der für die Abführung überschießender Feuchtigkeit gesorgt hätte. Den entsprechenden technisch plausiblen und fundierten Ausführungen des Sachverständigen, auf die der Kläger in seinem Vortrag Bezug nehme, sei der sachkundige Beklagte trotz Hinweises der Gegenseite nicht hinreichend substantiiert entgegentreten. Außerdem habe der Beklagte im Rahmen der Bauausführung seine ihn aus dem Architektenvertrag treffenden Überwachungspflichten verletzt. Hier spreche der Beweis des ersten Anscheins für einen Bauüberwachungsfehler, weil es sich um schwierige und gefahrträchtige Arbeiten handele und die vom Kläger vorgetragenen ‒ unstreitigen ‒ Zustände Baumängel darstellten. Entsprechendes gelte für den nicht hinreichend substantiiert bestrittenen Umstand, dass die eingebrachte Dampfbremse nicht den erforderlichen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis besitze. Es sei dem Beklagten nicht gelungen, diesen Anscheinsbeweis zu widerlegen, weil er trotz Hinweises der Gegenseite nicht hinreichend substantiiert dargetan habe, dass er seiner Verpflichtung zu einer ordnungsgemäßen Bauaufsicht nachgekommen sei. Was die Höhe des Kostenvorschusses angehe, sei der sachkundige Beklagte dem unter Bezugnahme auf die Ausführungen des Sachverständigen X. erfolgten substantiierten Vortrag der Klägerseite trotz Hinweises der Gegenseite ebenfalls nicht hinreichend substantiiert entgegengetreten. Wegen der weiteren Begründung wird gemäß § 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen (Bl. 4 ff. OLGA).
24
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung des Beklagten, mit der dieser seinen erstinstanzlichen Antrag auf Klageabweisung vollumfänglich weiterverfolgt. Der Beklagte meint, das Landgericht habe die Tatsachen, auch unter Verstoß gegen das Gebot rechtlichen Gehörs, nicht vollständig ermittelt, weil es diese allein aus dem Gutachten des Sachverständigen X. vom 31.05.2021 im selbständigen Beweisverfahren (8 OH 7/20) übernommen habe und die von ihm dort gestellten Ergänzungsfragen vom 10.08.2021 ‒ deren Inhalt er erstmals in der Berufungsbegründung wiedergibt ‒ unbeantwortet geblieben seien. Hierzu behauptet er ‒ vom Kläger unwidersprochen ‒, er sei aufgrund des bereits mit der Klageschrift gestellten Antrags auf Beiziehung des selbständigen Beweisverfahrens davon ausgegangen, dass sämtliche sachverständigen Feststellungen sowie Anträge auf rechtliches Gehör, insbesondere das Recht auf Beantwortung von Ergänzungsfragen, in die Entscheidung über den geltend gemachten Anspruch eingestellt würden, zumal das erkennende Gericht in beiden Verfahren identisch sei. Er meint, seine Beweisangebote in der Klageerwiderung hätten wenigstens dazu führen müssen, dass die Ergänzungsfragen noch beantwortet würden. Darauf beruhe auch das Urteil, denn sämtliche Ergänzungsfragen als auch die im Klageverfahren gemachten Beweisangebote hätten dazu geführt, dass der Kostenvorschussanspruch nicht bzw. nicht in dieser Höhe bejaht worden wäre. Außerdem hätte das Landgericht ein Mitverschulden des Klägers annehmen müssen, weil er diesen darauf hingewiesen habe, dass das Dach regelmäßig gewartet werden müsse, der Kläger dennoch keinen entsprechenden Wartungsvertrag abgeschlossen habe und die ordnungsgemäße Durchführung der Wartungsverträge, deren Gegenstand die regelmäßige Kontrolle der Funktion der feuchtevariablen Dampfbremse habe sein sollen, die Feuchtigkeitsschäden verhindert hätte. Seinen dazu bereits in erster Instanz erfolgten unstreitigen Vortrag habe das Landgericht gänzlich unbeachtet gelassen. Schließlich ist der Beklagte der Ansicht, es liege eine Überraschungsentscheidung vor, weil er aufgrund eines Beschlusses des Landgerichts im selbständigen Beweisverfahren vom 07.09.2022, laut dem sich der Sachverständige mit seinen Ergänzungsfragen auseinandersetzten sollte, davon habe ausgehen müssen, dass die Fragen noch beantwortet würden. Wenn das Landgericht der Meinung gewesen sei, dass eine Beweisaufnahme prozessual nicht angezeigt gewesen sei, hätte es zumindest den Beschluss vom 07.09.2022 aufheben oder einen deutlichen Hinweis dazu geben müssen.
25
Der Beklagte beantragt sinngemäß,
26
das am 09.02.2023 verkündete Urteil des Landgerichts Köln (Az. 8 O 328/21) abzuändern und die Klage abzuweisen.
27
Hilfsweise beantragt er,
28
das Urteil aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht zurückzuverweisen.
29
Der Kläger beantragt,
30
die Berufung zurückzuweisen.
31
Der Kläger verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vorbringens. Er meint, das Landgericht habe zu Recht angenommen, dass der sachkundige Beklagte trotz Hinweises des Klägers dem detaillierten Klagevortrag zu seinen Planungs- und Überwachungsfehlern nicht hinreichend substantiiert entgegengetreten sei und es deshalb einer Beweisaufnahme unter Beiziehung des OH-Verfahrens nicht bedurfte habe. Der Beklagte habe auch mit der Berufungsbegründung nicht vorgetragen, warum keine Planungs- und Überwachungsfehler vorlägen und/oder diese nicht schadenskausal geworden sein sollten. Allein die zitierten Ergänzungsfragen aus dem OH-Verfahren würden einen solchen Vortrag nicht ersetzen und diesen auch nicht beinhalten. Mit der Gehörsrüge habe der Beklagte aber konkreten, ihm vermeintlich abgeschnittenen Vortrag verbinden müssen. Jedenfalls sei das Ergebnis des Erstgerichts deshalb richtig, weil die Ergänzungsfragen zu keiner Korrektur der Ergebnisse des Gerichtssachverständigen X. geführt hätten. Hierzu behauptet der Kläger ‒ vom Beklagten unwidersprochen ‒, dieser Sachverständige habe mit dem mittlerweile vorliegenden 2. Ergänzungsgutachten vom 11.05.2023 sämtliche Ergebnisse des Hauptgutachtens (Anlage K 13) bestätigt. Außerdem meint der Kläger, ihn treffe keine Wartungsverpflichtung mit dem Inhalt der Kontrolle der Funktion der feuchtevariablen Dampfsperre. Der Vortrag des Beklagten dazu sei unsubstantiiert und widersprüchlich. Wegen der Einzelheiten wird auf S. 4 ff. der Berufungserwiderung (Bl. 160 ff. OLGA) Bezug genommen. Schließlich liege auch keine Überraschungsentscheidung vor, weil Entscheidungsreife gegeben gewesen sei und sich der Beklagte ausweislich der Berufungsbegründung lediglich in der irrigen Annahme befunden habe, vor Abschluss des OH-Verfahrens könne im Hauptsacheverfahren keine Entscheidung ergehen.
32
Mit Beschluss vom 23.11.2023 hat der Senat die Akten des selbstständigen Beweisverfahrens LG Köln, 8 OH 7/20, im Hinblick auf die hier streitgegenständlichen Mängel des Daches des Haupthauses zu Beweiszwecken beigezogen und diese zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht.
33
II.
34
Die zulässige Berufung des Beklagten hat in der Sache im Ergebnis keinen Erfolg. Zwar hat das Landgericht das Recht des Beklagten auf rechtliches Gehör verletzt, indem es ihn nicht darauf hingewiesen hat, dass es seinen Vortrag zu den im selbständigen Beweisverfahren gestellten Ergänzungsfragen für nicht hinreichend substantiiert hielt und deshalb unabhängig von dem Inhalt seiner Ergänzungsfragen und deren noch ausstehender Beantwortung zu entscheiden beabsichtigte. Das angefochtene Urteil beruhte auch auf diesem Gehörsverstoß, weil nicht auszuschließen war, dass die Entscheidung des Landgerichts anders ausgefallen wäre, wenn der Beklagte Gelegenheit gehabt hätte, den Inhalt der von ihm im selbständigen Beweisverfahren gestellten Ergänzungsfragen mitzuteilen. Nachdem der Beklagte dies zwischenzeitlich in der Berufungsbegründung nachgeholt und der Senat daraufhin Beweis erhoben hat, steht aber fest, dass das erstinstanzliche Urteil im Ergebnis zutreffend ist und daher keiner Abänderung bedarf. Im Einzelnen:
35
Das Landgericht hat letztlich zu Recht einen Anspruch des Klägers gegen den Beklagten auf Zahlung eines schadensgleichen Kostenvorschusses i.H.v. 258.308, 54 € aus §§ 633, 634 Nr. 4, 280 Abs. 1 BGB bejaht.
36
Der Beklagte hat eine Pflicht aus dem Architektenvertrag vom 23.08.2011 verletzt, weil er das von ihm erbrachte Architektenwerk mangelhaft erstellt hat. Ihm fallen sowohl Planungs- als auch Überwachungsfehler zur Last.
37
Das Landgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Planung der Dachkonstruktion durch den Beklagten nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht, weil der von ihm geplante gedämmte, jedoch ungeheizte Spitzboden weder den an einen kalten Dachraum noch den an einen warmen Dachraum zu stellenden Anforderungen genügt. Bei ersterem sind ‒ anders als im vorliegenden Fall ‒ gerade keine Zwischensparrendämmung im Dach und keine Dampfbremse zwischen Dachraum und Dachkonstruktion vorgesehen und für letzteren fehlt es an der zumindest bei gedämmten, jedoch ungeheizten und daher schadensträchtigen Spitzböden erforderlichen Belüftung der Dachkonstruktion. Dies hat der Kläger unter Bezugnahme auf das im selbständigen Beweisverfahren eingeholte Gutachten des Sachverständigen X. vom 31.05.2021 im Einzelnen dargelegt (Bl. 15 f. LGA) und der Beklagte ist dem nicht hinreichend entgegengetreten.
38
Sein Vortrag in der Klageerwiderung, es liege kein Mangel der Ausführungsplanung, insbesondere im Plan Nr. N02 vom 10.10.2013 vor (Bl. 157 LGA), zwischen dem 1.OG und dem Spitzboden sei eine Dämmung geplant und ausgeführt, dieser sei also gerade von den Wohnräumen abgegrenzt worden, und die Planung einer Zwischensparrendämmung im Dach und einer Dampfbremse zwischen Dachraum und Dachkonstruktion sei auch in dieser Kombination kein Mangel, weil diese Planung nicht bereits regelwidrig sei (Bl. 158 LGA), genügt dazu nicht. Denn dieser geht weder auf den Aspekt ein, dass der geplante Spitzboden wegen der Zwischensparrendämmung und der Dampfbremse zwischen Dachraum und Dachkonstruktion eben nicht kalt, sondern warm war, noch auf das Fehlen der bei diesem Anwendungsfall eines „warmen“ Dachraumes erforderlichen Belüftung. Warum die von ihm geplante Dachkonstruktion dennoch und trotz des Umstandes, dass die vom Kläger zitierten technischen Regelwerke einen Dachaufbau in der von ihm ausgeführten Art nicht kennen, regelgerecht sein sollte, hat der fachkundige Beklagte nicht dargelegt. Darauf, dass sein Vortrag insoweit nicht hinreichend substantiiert ist, hat ihn das Landgericht mit dem angefochtenen Urteil auch hingewiesen. Dennoch trägt der Beklagte zu der Thematik „Planungsfehler“ auch in der Berufungsbegründung nicht näher vor. Einer Beweisaufnahme darüber bedarf es daher nicht.
39
Auch über das Vorliegen eines Überwachungsfehlers muss im vorliegenden Fall kein Beweis erhoben werden. Das Landgericht ist insoweit zu Recht davon ausgegangen, dass hier wegen der am Dach vorhandenen Baumängel der erste Anschein dafür spricht, dass der Beklagte einen Bauüberwachungsfehler begangen hat, und dass der Beklagte diesen Anscheinsbeweis nicht durch substantiiertes Vorbringen entkräftet hat. Zwar kann der Beweis des ersten Anscheins in Bezug auf einen Bauüberwachungsfehler nur bei Mängeln an Arbeiten angenommen werden, die in jedem Fall einer umfangreichen Bauaufsicht des Architekten bedürfen. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, war das bei den hier streitgegenständlichen Dachdeckerarbeiten, die u.a. die Ausführung von Dampfsperrbahnen und einer Wärmedämmung beinhalteten, aber der Fall, weil es sich dabei um schwierige bzw. gefahrträchtige Arbeiten handelte. Jedenfalls dass beide Dampfbremsen an unverputztes Mauerwerk angeschlossen waren, dass die untere Dampfbremse nicht abgedichtete Durchdringungen durch Rohre und Kabel aufwies (Bl. 14 LGA), dass die Dachschalung bereits beim Einbau partiell feucht war (Bl. 17 LGA) und dass die eingebrachten Dampfbremsen nicht den erforderlichen bauaufsichtlichen Verwendungsnachweis besaßen, wäre bei der gebotenen Überwachung der Dachdeckerarbeiten durch den Beklagten für diesen ohne weiteres erkennbar gewesen.
40
Demgegenüber kann er sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass seine Mitarbeiterin, die Zeugin L., den Einbau der Dichtheitsschicht überwacht habe (Bl. 159 LGA). Abgesehen davon, dass dieser Einbau ohnehin nur einen Teil der Dachdeckerarbeiten ausmachte, hätte es insofern auch detaillierten Vortrags dazu bedurft, was genau die Zeugin L. denn insoweit geprüft hat. Wie sie laut dem Vortrag in der Klageerwiderung festgestellt haben soll, dass die Luftundichtigkeiten, die der Kläger auf S. 10 unter lit. a) der Klageschrift benannt hat, zum Zeitpunkt der Einbringung der Dichtheitsschicht zwischen Obergeschoss und Spitzboden nicht vorhanden waren (Bl. 159 LGA), erschließt sich nicht. Soweit der Beklagte pauschal behauptet, wenn es hier weiterhin zu Durchlässigkeiten komme, seien diese auf Materialbeschädigungen zurückzuführen, die nicht im Rahmen der Überwachung erkennbar gewesen seien (Bl. 159 LGA), setzt er sich weder mit den vom Kläger in Bezug genommenen Fotos auseinander, noch legt er dar, was hier wann und wie beschädigt worden sein soll. Auch in Bezug auf das Vorliegen eines Überwachungsfehlers ist der Beklagte bereits durch das landgerichtliche Urteil auf die fehlende Substanz seines Vortrags hingewiesen worden, ohne dass er dem in der Berufungsbegründung Rechnung getragen hätte.
41
Soweit der Beklagte meint, auch das Thema „feuchtevariable Dampfbremse“ führe nicht zu einem Mangel, und dazu ausführt, dass zum Zeitpunkt des ‒ von der Zeugin L. überwachten ‒ Einbaus kein erhöhtes Raumklima vorgeherrschte habe (Bl. 159f LGA) bzw. er die Umstände für den fachgerechten Einbau der feuchtevariablen Dampfbremse kontrolliert und überwacht habe, die am Tag des Einbaus gegeben gewesen seien (Bl. 232 LGA), übersieht er, dass bereits der Einbau einer feuchtevariablen Dampfbremse ohne den erforderlichen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis einen Mangel verursachte. Auf die Frage, ob während des Einbaus eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Gebäude herrschte, die der Beklagte bzw. die Zeugin L. hätte begrenzen müssen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit über die feuchtevariable Dampfbremse in die Dachkonstruktion zu verhindern, kommt es im Ergebnis auch nicht an, weil der Sachverständige diese Pflichtverletzung ohnehin nicht für eine erwiesene, sondern nur für eine sehr wahrscheinliche Schadensursache gehalten hat (Bl. 113 LGA) und sich der Beklagte von den anderen oben dargelegten Pflichtverletzungen nicht entlastet hat.
42
Dass der Beklagte letztere zu vertreten hat, wird gemäß § 280 Abs. 1 S. 2 BGB vermutet.
43
Durch diese Pflichtverletzungen ist dem Kläger auch ein Schaden entstanden, weil sich die Planungs-und Überwachungsfehler des Beklagten im Dach seines Bauwerks bereits in Form von Mängeln verwirklicht haben und der Kläger die zu deren Beseitigung erforderlichen Kosten vorfinanzieren muss. Daher kann er den entsprechenden Betrag als Vorschuss vom Beklagten verlangen.
44
Dieser Vorschuss muss jedenfalls die Kosten abdecken, die durch die Änderung der fehlerhaft geplanten Dachkonstruktion in eine regelgerechte Dachkonstruktion anfallen werden, sowie die Kosten, die für den Austausch der Dampfbremsen ohne bauaufsichtlichen Verwendungsnachweis und der bereits beim Einbau feuchten Teile der Dachschalung entstehen werden. Denn diese Kosten wären nicht entstanden, wenn der Beklagte die Dachkonstruktion ordnungsgemäß geplant und deren Ausführung ordnungsgemäß überwacht hätte. Darüber hinaus muss der Vorschuss aber auch solche Kosten umfassen, die für die Beseitigung von Schäden am Dach anfallen werden, die erst infolge der nicht regelgerechten Dachkonstruktion, der nicht luftdicht angeschlossenen Dampfbremsen und der partiell feuchten Teile der Dachschalung entstanden sind.
45
Der Kläger hat die Kosten für die Schadensbeseitigung und mangelfreie Herstellung eines warmen Dachraums unter Berufung auf die Ermittlung des Gerichtssachverständigen X. mit 224.036,54 EUR Baukosten und 34.272,00 EUR Planungskosten, mithin in Summe 258.308,54 EUR beziffert und das Landgericht hat gemeint, der sachkundige Beklagte sei diesem substantiierten Vortrag zur Erforderlichkeit und Angemessenheit der Kosten trotz Hinweises der Gegenseite nicht hinreichend substantiiert entgegengetreten.
46
Der Beklagte hat allerdings auf S. 4 oben der Klageerwiderung vorgetragen, die Ausführungsplanung habe nicht zu einem Mangel bzw. Schaden geführt, sondern warme feuchte Luft habe allenfalls durch die Luftdichtheitsebene gelangen können; der Gerichtsgutachter habe bis jetzt nicht feststellen können, dass für die monierten Schäden die Ausführungsplanung ursächlich gewesen sei. Außerdem hat der Beklagte auf S. 5 der Klageerwiderung unter der Überschrift „4. Zur Schadenshöhe“ nicht nur die Ursächlichkeit seiner konkreten Ausführungsplanung sowie die Ursächlichkeit von bestrittenen Überwachungsfehlern für den unter 7.f) behaupteten Schaden bestritten, sondern auch erklärt, weiterer Vortrag zu den behaupteten Mängeln bzw. zu der Beweissituation folge, sobald auf die Ergänzungsfragen im Beweisverfahren eingegangen worden sei.
47
Damit hat der Beklagte zum Ausdruck gebracht, dass er die Schadenshöhe im Einzelnen bestreiten will und dies Gegenstand seiner Ergänzungsfragen im selbständigen Beweisverfahren ist. Mit Blick darauf, dass der Kläger bereits zuvor die Hinzuziehung der Akte LG Köln, AZ: 8 OH 7/20, mithin des selbständigen Beweisverfahrens beantragt hatte, er deren Inhalt also kannte und dieses Verfahren von derselben Kammer bearbeitet wurde, die mit dem hiesigen Hauptsacheverfahren befasst war, ist fraglich, ob der Beklagte diese Ergänzungsfragen im Hauptsacheverfahren noch einmal wiederholen musste oder ob nicht bereits die (konkludente) Bezugnahme auf diese allen Beteiligten bekannten Fragen ausreichte. Auch wenn man letzteres mit dem Landgericht verneint, hätte dieses den Beklagten aber jedenfalls darauf hinweisen müssen, dass es seinen Vortrag insoweit für nicht hinreichend substantiiert hielt und deshalb unabhängig von dem Inhalt seiner Ergänzungsfragen und deren noch ausstehender Beantwortung zu entscheiden beabsichtigte. Damit hat es das Recht des Beklagten auf rechtliches Gehör verletzt.
48
Das angefochtene Urteil beruhte auch auf diesem Gehörsverstoß. Denn es war nicht auszuschließen, dass die Entscheidung des Landgerichts anders ausgefallen wäre, wenn der Beklagte Gelegenheit gehabt hätte, diesem den Inhalt der nun in der Berufungsbegründung aufgeführten Ergänzungsfragen mitzuteilen. Wenn der Beklagte mit seinem Bestreiten der Schadenshöhe Erfolg gehabt hätte, hätte das Landgericht den Vorschussanspruch nämlich nicht bzw. nicht in der zuerkannten Höhe von 258.308,54 € ohne Beweisaufnahme zusprechen dürfen.
49
Nach dem Ergebnis der zwischenzeitlich vom Senat durchgeführten Beweisaufnahme steht allerdings fest, dass ein Vorschuss in mindestens dieser Höhe erforderlich ist, um den Aufwand für die Schadensbeseitigung und mangelfreie Herstellung eines warmen Dachraums abzudecken, so dass sich das erstinstanzliche Urteil im Ergebnis nach Beweisaufnahme dennoch als richtig erweist.
50
Der Sachverständige X. hat festgestellt, dass zur mängelfreien Erstellung der Dachkonstruktion deren Rückbau und Neuerrichtung erforderlich sind, und geschätzt, dass dafür Baukosten i.H.v. 224.036,54 € und Planungskosten i.H.v. 34.272,00 € anfallen werden. Er hat mittlerweile sämtliche in der Berufungsbegründung wiedergegebenen Fragen des Beklagten zu seinem Hauptgutachten, nämlich
51
- aufgrund welcher fehlerhaft durchgeführten Planungs- oder Überwachungsleistung des Antragsgegners die geborgenen Schiefernägel korrodiert seien und ob dadurch deren Funktion unbrauchbar geworden sei,
52
- ob der vorgefundene Besatz mit Schimmelpilz das Holz oder andere am Dach eingesetzte Materialien beeinträchtige oder gar zerstören könne,
53
- ob die zu c) im Gutachten betrachteten Baustoffe aus Holz für den weiteren Einsatz innerhalb der Konstruktion unbrauchbar bzw. gesundheitsschädigend seien,
54
- wo und wie im Einzelnen die nicht luftdichten Klebeverbindungen dazu führen würden, dass eine negative Abweichung zum Vertragssoll entstehe,
55
- ob die bemängelten Anschlussstellen der Dampfsperre auch nachträglich noch abgedichtet werden könnten und welche Auswirkung das dann auf die unter a) bis g) aufgeführten Erscheinungen haben werde,
56
- ob er ausschließen könne, dass die Schäden an der straßenseitigen Giebeltympanie durch Feuchtigkeitseintrag der Bauteilöffnung entstanden seien und ob er wisse, seit wann diese Bauteilöffnungen bestanden hätten,
57
- wie sich die von ihm bemängelten Luftundichtigkeiten von Innen nach Außen diesbezüglich auswirken würden sowie welcher Dämmwert für die Dachflächen notwendig gewesen wäre, damit von einem Kaltraum die Rede sei, sowie
58
- welche Vor- und Nachteile der warme Dachraum gegenüber der Nachbesserungsmöglichkeit des kalten Dachraums habe und wie sich die Kosten hierzu verhalten würden,
59
gut nachvollziehbar und überzeugend beantwortet. Wegen des Inhalts der Antworten wird auf das 2. Ergänzungsgutachten des Sachverständigen vom 07.09.2022, dort S. 13 bis 18 (Bl. 698 bis 703 BA) Bezug genommen.
60
In diesem Ergänzungsgutachten hat der Sachverständige auch ‒ wie vom Beklagten gefordert ‒ nochmals Stellung zu den Mangelursachen genommen und begründet, warum alles ausgetauscht und saniert werden musste. Hierzu hat er zum einen erklärt, dass es auch nach nochmaliger inhaltlicher Auseinandersetzung mit der Thematik bei den Antworten aus dem Gutachten vom 31.05.2021 bleibe (S. 16 des 2. Ergänzungsgutachtens, Bl. 701 BA), und zum anderen ausgeführt, dass die Schieferstifte korrodiert seien, die Dachschalung schimmelpilzbefallen sei, die Dachsparren zumindest teilweise schimmelpilzbefallen seien, die Wärmedämmung zumindest in Teilbereichen mit Pilzsporen belegt sei, die Verklebung der Dampfbremse(n) fehlerhaft sei, das Giebelmauerwerk unverputzt sei, die Dachkonstruktion insgesamt fehlerhaft geplant sei und umgebaut werden müsse, die eingebaute feuchtevariable Dampfbremse über keinen bautechnischen Verwendbarkeitsnachweis verfüge und gar nicht hätte eingebaut werden dürfen, die Dampfbremse unter dem OSB-Boden des Spitzbodens Fehlstellen aufweise, die außenliegenden Gesimse aus Holzwerkstoffen pilz-und schimmelpilzbefallen seien und dass all das Vorgenannte in Summe die Maßnahmen und Kosten aus dem Gutachten vom 31.05.2021 ab Seite 44 begründe (S. 17 des 2. Ergänzungsgutachtens, Bl. 702 BA).
61
Soweit der Beklagte außerdem gefordert hat, der Sachverständige solle seine Hypothese zur Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion im Zusammenhang mit der feuchtevariablen Dampfbremse anhand der von ihm vorgelegten Dokumentation des Bauablaufs prüfen, hat der Sachverständige zu Recht darauf hingewiesen, dass ihm keine entsprechenden Dokumentationen vorlägen und auch keine in der Akte hätten erkannt werden können (S. 16 des Ergänzungsgutachtens, Bl. 701 BA).
62
Der Senat verkennt nicht, dass der Beklagte im selbständigen Beweisverfahren mit Schriftsatz vom 05.07.2023 (Bl. 757 ff. BA) noch weitere Ergänzungsfragen gestellt hat. Insofern bedarf es aber keiner weiteren Begutachtung mehr, weil sich die Antworten auf diese Fragen entweder bereits aus den schon vorliegenden Ausführungen des Sachverständigen ergeben oder sie nicht entscheidungserheblich sind. Im Einzelnen:
63
Die Frage des Beklagten, wie er davon ausgehen könne, dass unter jeder einzelnen Dachfläche dieselbe erhöhte Feuchtigkeit, insbesondere stark korrodierte Schiefernägel aufgrund mangelhafter Planung und Überwachung vorzufinden seien und ob er ausschließen könne, dass die anderen Dachflächen (als die untersuchte) nicht sanierungsbedürftig seien, ist für die Entscheidung des hiesigen Rechtsstreits ohne Belang. Denn die Schiefernägel müssen jedenfalls deshalb erneuert werden, weil die Dachkonstruktion vom Beklagten insgesamt fehlerhaft geplant worden ist und deshalb umgebaut werden muss. Die Errichtung des vertraglich geschuldeten warmen Dachraums erfordert nämlich bereits ausweislich des Hauptgutachtens des Sachverständigen einen Rückbau der Schiefereindeckung (vgl. S. 44 des Hauptgutachtens, Bl. 162 BA). Dieser wiederum ist bereits denknotwendig nicht ohne eine Entfernung der Schiefernägel möglich, wobei letztere zwangsläufig beschädigt werden können, so dass eine uneingeschränkte Weiterverwendung dieser Nägel selbst dann nicht in Betracht kommt, wenn sie nicht korrodiert sein sollten.
64
Es ist auch nicht nötig, den Sachverständigen dazu zu befragen, ob er ausschließen könne, dass der (auf der Dachschalung) vorgefundene Schimmelpilzbesatz noch nicht abgestorben und damit zerstörend sei. Dass die Antwort auf diese Frage „nein“ lautet, ergibt sich nämlich bereits aus dem Laborbericht der BMA-Labor GbR vom 29.03.2021, in dem es auf S. 2 (Bl. 171 BA) heißt: „… Mit dieser Methode kann jedoch nicht bestimmt werden, ob die Schimmelpilzart noch kultivierbar oder schon abgestorben ist“. Dass der Sachverständige diesen Laborbericht bei seinen Feststellungen berücksichtigt hat, folgt daraus, dass er ihn dem Hauptgutachten als Anlage beigefügt hat.
65
Die Frage, ob dem Sachverständigen eine verifizierbare und nachprüfbare Messung zur Verfügung stehe, wonach die Dachkonstruktion unter sämtlichen Dachflächen des Gebäudes bereits dermaßen geschädigt sei, dass diese ersetzt werden müsse, bedarf ebenfalls keiner (nochmaligen) Beantwortung, weil sie schon geklärt ist. Hierzu hat der Sachverständige nämlich bereits in seinem Hauptgutachten ausgeführt, dass im Rahmen einer Ortsbesichtigung nicht die gesamte Konstruktion zurückgebaut und freigelegt werden könne und sich daher auf die Erkenntnisse der Bauteilöffnungen berufen werde (S. 43 des Hauptgutachtens, Bl. 161 BA). Selbstverständlich kann und muss der Sachverständige für die Ermittlung eines Kostenvorschusses nicht die gesamte Dachkonstruktion zerstörend untersuchen; die Beprobung einer aussagekräftigen Anzahl von Stellen ist ausreichend. Das ist hier durch den Sachverständigen erfolgt. Eine derart detaillierte Tatsachenfeststellung, wie sie der Beklagte fordert, ist insbesondere in einem Vorschussprozess nicht erforderlich.
66
Die vom Beklagten im Zusammenhang mit den Luftundichtigkeiten zwischen dem Spitzboden und dem Außenbereich gestellte Ergänzungsfrage, ob der Sachverständige ausschließen könne, dass ursprünglich überwachte luftdichte Klebeverbindungen sich später wieder lösen könnten, ist für die Entscheidung des Rechtsstreits ebenfalls ohne Belang. Auch wenn man zugunsten des Beklagten unterstellen würde, dass der Sachverständige dies nicht ausschließen kann, und deshalb insoweit ein Überwachungsfehler zu verneinen wäre, müsste die Dampfbremse zwischen dem Spitzboden und dem Außenbereich nämlich jedenfalls deshalb ersetzt ‒ und dann natürlich auch ordnungsgemäß verklebt ‒ werden, weil sie nicht den erforderlichen bauaufsichtlichen Verwendungsnachweis besitzt (vgl. S. 40 des Hauptgutachtens, Bl. 158 BA) und weil das Dach ohnehin umgebaut werden muss, um die vom Sachverständigen X. festgestellte „grundlegende konzeptionelle Fehlplanung“ (S. 38 des Hauptgutachtens, Bl. 156 BA) zu beseitigen. Dieser Umbau beinhaltet zwangsläufig einen Austausch der Dampfbremse, weil er u.a. den Rückbau der Dämmung in der Dachschräge umfasst (vgl. S. 44 des Hauptgutachtens, Bl. 162 BA), der wiederum nur erfolgen kann, wenn man zuvor die vorhandene Dampfbremse, die sich unterhalb dieser Dämmung befindet (vgl. Traufdetail/Dachaufbau S. 40 des Hauptgutachtens, Bl. 158 BA), entfernt und sie nach Erstellung einer neuen Zwischensparrendämmung neu errichtet (vgl. S. 46 des Hauptgutachtens, Bl. 164 LGA).
67
Mit einer entsprechenden Begründung ist auch die die Luftundichtigkeiten zwischen Obergeschoss und Spitzboden betreffende Ergänzungsfrage, ob, wenn alle fehlerhaften Anschlussstellen wieder ordnungsgemäß verschlossen würden und vorher eine Trocknung des Zwischenraumes durchgeführt werde, die Schadensursächlichkeit behoben werden könne, zu verneinen. Denn auch die dortige Dampfbremse müsste jedenfalls deshalb ersetzt werden, weil sie nicht den erforderlichen bauaufsichtlichen Verwendungsnachweis besitzt.
68
Soweit der Beklagte außerdem wissen möchte, warum die von ihm erwähnte Sanierungsmöglichkeit, die Decke nicht zu öffnen und die Luftdichtheitsebene ins Dachgeschoss zu verschieben, ausgeschlossen werde, ergibt sich die Antwort bereits aus dem Vorstehenden. Abgesehen davon ist auch nicht ersichtlich, wie der Beklagte es bewerkstelligen will, die Luftdichtheitsebene ohne eine Öffnung der Decke zu verschieben. Denn dafür wäre eine Entfernung der Dampfbremse zwischen Obergeschoss und Spitzboden erforderlich. Da sich diese unterhalb der OSB-Schalung befindet (vgl. Traufdetail/Dachaufbau S. 40 des Hauptgutachtens, Bl. 158 BA), müsste man aber zwangsläufig den vom Beklagten als „Decke“ bezeichneten Boden des Spitzbodens öffnen, um sie zu entfernen.
69
Der Senat muss den Sachverständigen im Zusammenhang mit der Pilzbildung im Bereich der profilierten Gesimse auch nicht fragen, ob er den Bericht des BZR-Institutes, auf den er sich stütze, auf Plausibilität geprüft habe und ob er zwangsläufig seine Annahme auch auf die restliche Dachkonstruktion, die nicht geöffnet worden sei, übertrage. Denn auch darauf kommt es für die Entscheidung des Rechtsstreits nicht an. Bereits in seinem Hauptgutachten hat der Sachverständige (dort auf S. 29 f, Bl. 147 BA) dargelegt, dass es über nicht luftdichte Anschlüsse der Dampfbremse an das unverputzte Mauerwerk sowie durch unvermörtelte Stoßfugen des Mauerwerks infolge des Dampfdruckgefälles dazu komme, dass warme, mit Feuchtigkeit angereicherte Raumluft aus dem Spitzbodenbereich durch das Mauerwerk bis in die Gesimskästen ströme, sich auf diesem Weg nach außen abkühle und es dann dort zu Tauwasserausfall komme, der wiederum Bauschäden wie Fäulnis und Schimmelpilzbildung, aber auch abplatzende Farbe, zur Folge haben könne. Den Bericht des BZR-Instituts hat er in seinem 2. Ergänzungsgutachten (dort auf S. 16, Bl. 701 BA) lediglich erwähnt, um zu erklären, warum er einen Zusammenhang der Schäden an der straßenseitigen Giebeltympanie mit nachträglicher, erst durch die Bauteilöffnungen des Privatsachverständigen eingetragener Feuchtigkeit von außen ausschließt. Dieser Begründung hätte es aber gar nicht bedurft, weil zwischen den Parteien unstreitig war und ist, dass der Kläger bereits im Mai 2018 Feuchtigkeitsschäden an der Dachuntersicht gerügt hatte und dass die Mitarbeiterin des Beklagten ihm im Mai 2019 eine Tabelle übersandt hatte, aus der sich das Vorhandensein solcher Feuchtigkeitsschäden ergab (vgl. Anlage K3, Bl. 26 f. LGA). Daher stand schon deshalb fest, dass die erst mehrere Monate später, nämlich erst am 04.10.2019 erfolgten Bauteilöffnungen durch den Privatsachverständigen hier nicht schadensursächlich gewesen sein können.
70
Entgegen der Ansicht des Beklagten hat der Sachverständige seine (Kern-)Frage, warum alles ausgetauscht und saniert werden müsse, in seinem 2. Ergänzungsgutachten bereits beantwortet. Wie oben dargelegt, hat er dazu nämlich erklärt, dass die Summe aller von ihm im Einzelnen genannten Schäden die Maßnahmen und Kosten aus dem Gutachten vom 31.05.2021 ab Seite 44 begründe. Angesichts dessen erübrigt es sich, den Sachverständigen, wie vom Beklagten beantragt, zu fragen, warum er davon ausgehe, dass die gesamte Dachkonstruktion feucht und befallen sei und ausgetauscht werden müsse. Denn der Sachverständige hat damit bereits dargelegt, weshalb er meint, dass die gesamte Dachkonstruktion ausgetauscht werden muss. Ob er ‒ wie der Beklagte unterstellt ‒ außerdem davon ausgeht, dass die gesamte Dachkonstruktion feucht und befallen ist, kann dahinstehen. Deren Erneuerung ist nämlich jedenfalls deshalb erforderlich, weil die Dachkonstruktion infolge der fehlerhaften Planung und wegen der ungeeigneten Dampfbremsen komplett umgebaut werden muss.
71
Zwar mag es Teile dieser Konstruktion geben, die weder von Feuchtigkeit noch von Schimmel befallen sind und die deshalb nach dem Rückbau des Daches bei dessen fachgerechter Neuerrichtung wiederverwendet werden können. Hinreichend sicher ist das aber nicht. Denn zum einen konnte sich die Feuchtigkeit im Dachstuhl dort mittlerweile über einen Zeitraum von acht Jahren hinweg ungehindert ausbreiten und zum anderen setzt eine Wiederverwendung von Teilen der Dachkonstruktion voraus, dass diese bei den noch vorzunehmenden Abrissarbeiten nicht beschädigt werden. Ob und in welchem Umfang weder durch die Feuchtigkeit noch durch die Abrissarbeiten beeinträchtigte Bauteile vorhanden sein werden, lässt sich derzeit nicht beurteilen, sondern wird sich erst im Zuge der Schadensbeseitigung zeigen. Daher ist der Sachverständige bei der Schätzung der für letztere voraussichtlich erforderlichen Kosten zu Recht davon ausgegangen, dass alle Materialien erneuert werden müssen. Sollte sich im Laufe der Arbeiten herausstellen, dass das tatsächlich nicht der Fall ist, kann (und muss) diesem Umstand bei der anschließend vom Kläger vorzunehmenden Abrechnung über den Vorschuss Rechnung getragen werden.
72
Im Anschluss an die Ausführungen des Sachverständigen schätzt der Senat den Schaden des Klägers hier auf mindestens 258.308,54 €. Zwar ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Kosten für die stärkere Dämmung des Spitzbodens um Sowiesokosten handelt, um die der Anspruch an sich gekürzt werden müsste, weil sie dem Kläger auch bei mangelfreier Vertragsdurchführung entstanden wären. In Anbetracht dessen, dass der Sachverständige die Kosten für die gesamte Dämmung des Spitzbodens (also für die Unterdeckplatte, die Schubbohle, die Konterlatte, die Zwischensparrendämmung nach EnEv-Standard, die Dampfbremse und die Stützlattung) im 2 Ergänzungsgutachten lediglich mit rund 21.500,00 € netto, mithin 25.585,00 € brutto beziffert hat (dort auf S. 18, Bl. 703 BA) und dieser Betrag nicht einmal 10 % der Gesamtkosten ausmacht, während die seit der Erstellung der Kostenschätzung im Mai 2021 eingetretene Baukostensteigerung bekanntermaßen weit darüber liegt, sieht der Senat aber keinen Anlass für eine Herabsetzung des Vorschussbetrages.
73
Mit seinem Einwand, das Urteil des Landgerichts sei rechtsfehlerhaft, weil es ein anspruchsverkürzendes Mitverschulden seitens des Klägers hätte annehmen müssen, dringt der Beklagte ebenfalls nicht durch. Richtig ist zwar, dass das Landgericht den Vortrag des Beklagten in der Klageerwiderung auf S. 4 unten nicht beachtet hat, zwischen den Parteien sei im Rahmen der Ausführungsplanung besprochen und darauf hingewiesen worden, dass das Dach regelmäßig gewartet werden müsse, hierzu sei dem Kläger aufgegeben worden, Wartungsverträge zu schließen, und im Rahmen dieser Wartungen hätte kontrolliert werden müssen, ob die feuchtevariable Dampfbremse hier konkret ordnungsgemäß arbeite (Bl. 159 LGA). Es stimmt auch, dass der Kläger diesen Vortrag in erster Instanz nicht bestritten hat. Der Kläger weist allerdings in seiner Berufungserwiderung zutreffend darauf hin, dass der Beklagte schon nicht behauptet, dass er ihn auf die Notwendigkeit einer solchen Wartung, konkret mit dem Inhalt der Kontrolle der Funktion der feuchtevariablen Dampfsperre hingewiesen habe, sondern dass der Beklagte lediglich meine, dass die Funktionskontrolle bei einer Wartung des Daches dazugehören müsse. Auch die weitere (hier nur sinngemäß wiedergegebene) Argumentation des Klägers, es sei nicht ersichtlich, woraus sich ein solcher Wartungsinhalt ergebe, woher er dies hätte wissen sollen/müssen, wann er eine Wartung versäumt habe, was er im Zuge der Wartung konkret hätte feststellen sollen und wie sich die fehlende Feststellung schadenserhöhend ausgewirkt habe, trifft im Wesentlichen zu. Dem Vorbringen des Beklagten lässt sich nämlich nur entnehmen, dass der Kläger im Zuge der Wartung Feuchtigkeit hätte feststellen sollen.
74
Soweit der Beklagte dazu in der Berufungsbegründung vorträgt, Inhalt der Wartungsverträge habe sein sollen, die Funktion der feuchtevariablen Dampfbremse regelmäßig zu kontrollieren, diesen Wartungsvertrag habe der Kläger nicht abgeschlossen, denn sonst wäre die Feuchtigkeit aufgefallen, stellt sich die Frage, welche Feuchtigkeit bei einer regelmäßigen Kontrolle der Funktion der feuchtevariablen Dampfbremse wo und wie hätte auffallen sollen. Dass im Spitzboden, wo diese Dampfbremse verbaut war, sichtbare Feuchtigkeitserscheinungen vorhanden gewesen seien, hat nämlich keine der Parteien behauptet. Vielmehr hat die Zeugin L. dem Kläger noch zu einem Zeitpunkt, an dem sich außen an der Dachuntersicht schon Feuchtigkeitsschäden zeigten, mitgeteilt, dass an seinem Dach bei einer Öffnung der Konstruktion kein Fehler in dieser habe festgestellt werden können, dass die Dachhaut laut der Firma P. keine Schäden aufgewiesen habe, dass ein ihrerseits geöffnetes Brett im Bereich des Balkons seiner Tochter trocken gewesen sei und dass auch die drei Bereiche, die sie im Spitzboden geöffnet hätten, trocken gewesen seien (E-Mail vom 28.11.2018, Anlage K2, Bl. 23 LGA). Wie ein mit der Wartung der feuchtevariablen Dampfbremse beauftragter Handwerker dann sogar ohne eine Bauteilöffnung Feuchtigkeit hätte feststellen sollen, erschließt sich nicht.
75
Wie das Landgericht zutreffend erkannt hat, stehen dem Kläger auch die übrigen mit der Klage geltend gemachten Ansprüche gegen den Beklagten zu.
76
Die Kostenentscheidung beruht, was die Zurückweisung der Berufung anbelangt, auf § 97 Abs. 1 ZPO. Soweit dem Beklagten die Kosten des selbständigen Beweisverfahrens und den dortigen Nebenintervenienten die Kosten der Nebenintervention auferlegt worden sind, ergibt sie sich aus §§ 91 Abs. 1. S. 1, 101 Abs. 1 ZPO.
77
Die Kosten eines vorausgegangenen selbständigen Beweisverfahrens gehören auch dann zu den Kosten des Hauptsacheverfahrens, wenn dessen Streitgegenstand und der Gegenstand des selbständigen Beweisverfahrens nur teilweise identisch sind (BGH, Beschluss vom 10. Januar 2007 ‒ XII ZB 231/05 ‒, juris). War der Untersuchungsstoff des Beweisverfahrens Gegenstand mehrerer Hauptsacheprozesse, so sind die Kosten des Beweisverfahrens nach dem Verhältnis der Einzelstreitwerte anteilig umzulegen (MüKoZPO/Schulz, 6. Aufl. 2020, ZPO § 91 Rn. 29 m.w.N.).
78
Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Das selbständige Beweisverfahren betraf neben den hier streitgegenständlichen Mängeln und Mangelfolgeschäden weitere Mängel und Mangelfolgeschäden, die Gegenstand eines anderen Hauptsacheprozesses, nämlich des Verfahrens LG Köln, 8 O 41/23 waren. Die Einzelstreitwerte des selbständigen Beweisverfahrens sind aus Sicht des Senats wie vom dortigen Antragstellervertreter angegeben mit 258.308,00 € für die im vorliegenden Prozess geltend gemachten Schäden und mit rund 236.000,00 € für die übrigen, hier nicht streitgegenständlichen Schäden zu bemessen. Da der Beklagte im hiesigen Prozess voll unterliegt und der auf die hier streitgegenständlichen Mängel und Mangelfolgeschäden entfallende Einzelstreitwert 52 % des Gesamtstreitwerts des selbständigen Beweisverfahrens ausmacht, waren dem Beklagten die Kosten des selbständigen Beweisverfahrens also in Höhe von 52 % (258.308,00 € : 494.308,00 € x 100 = 52,26 %) aufzuerlegen. Da dem selbständigen Beweisverfahren zwei Nebenintervenienten auf Seiten des Beklagten beigetreten waren, war außerdem gemäß § 101 Abs. 1 ZPO auszusprechen, dass diese 52 % der Kosten ihrer Nebenintervention selbst tragen. Über die übrigen Kosten des selbständigen Beweisverfahrens und der dortigen Nebenintervention konnte der Senat nicht entscheiden, weil der Streitgegenstand des hiesigen Hauptsacheprozesses und der Gegenstand des selbständigen Beweisverfahrens insoweit nicht übereinstimmen.
79
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
80
Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision gemäß § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Weder hat die Sache grundsätzliche Bedeutung noch ist eine Entscheidung des Revisionsgerichts zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich.