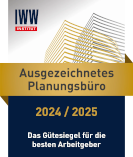17.10.2018 · IWW-Abrufnummer 204957
Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen: Urteil vom 22.03.2018 – 7 A 1388/15
Diese Entscheidung enthält keinen zur Veröffentlichung bestimmten Leitsatz.
Oberverwaltungsgericht NRW
Tenor:
Die Berufung wird zurückgewiesen.
Die Beigeladene trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Beigeladene darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i. H. v. 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht zuvor der jeweilige Vollstreckungsgläubiger i. H. v. 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages Sicherheit leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
1
Tatbestand:
2
Die Klägerin wendet sich als Nachbarin gegen eine der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung zum Umbau eines Wohn- und Geschäftshauses in ein Wohnhaus.
3
Die Klägerin ist Miteigentümerin des Grundstücks Gemarkung N., Flur 205, Flurstück 275 (C.-straße 14). Das Grundstück liegt östlich des Vorhabengrundstücks Gemarkung N., Flur 205, Flurstücke 757, 896, 897 und 898, mit den postalischen Bezeichnungen C.-straße 16a, 16b, H.-straße 23, 23a, 23b und 25, dessen Eigentümerin die Beigeladene war.
4
Unter dem 30.11.2011 stellte die Beigeladene den Baugenehmigungsantrag. Mit Schreiben vom 2.2.2012 teilte die Beklagte der Beigeladenen u.a. mit, dass die Dachaufbauten auf beiden Dachflächen des Gebäudes C.-straße 16b Abstandsflächen auslösten, die sich auf das Grundstück C.-straße 14 erstreckten; dies gelte auch für beide Balkone im Dachgeschoss mit einer Tiefe von 1,70 m. Daraufhin unterzeichneten die Eigentümer des Grundstücks C.-straße 14 unter dem 1.3.2012 auf den Bauvorlagen der Beigeladenen Zustimmungserklärungen, die die Beigeladene bei der Beklagten einreichte. Zuvor hatte die Beigeladene mit den Eigentümern des Nachbargrundstücks unter dem 27.2.2012 eine privatschriftliche Vereinbarung getroffen, in der es u. a. heißt:
5
„ …4. Der Bauträger verkauft den Nachbarn den Tiefgaragenstellplatz mit der Bezeichnung TG 2.3 zum Preis von 5000,00 €. Sollten die Doppelparker durch Einzelparker ersetzt werden, kommt der Tiefgaragenplatz mit der heutigen Bezeichnung DP 1.3 zum Tragen“….
6
„6. Die Nachbarn erteilen dem Bauträger unwiderruflich durch Unterschriftsleistungen unter dieser Vereinbarung und auf den Bauplänen, Pläne 1 bis 5 vom 16.2.2012 mit den kenntlich gemachten Zustimmungsbereichen 1 bis 7, ihre Zustimmung zur geplanten Nutzungsänderung und Bebauung“….
7
Unter dem 5.4.2012 erteilte die Beklagte die Baugenehmigung und erließ unter demselben Datum einen Abweichungsbescheid der unter anderem eine Abweichung von der Vorschrift des § 6 BauO NRW zulasten des Grundstücks C.-straße 14 zulässt.
8
Mit Schreiben vom 12.3.2013 teilte die Beigeladene den damaligen Bevollmächtigten der Eigentümer des Grundstücks C.-straße 14 mit, dass sie die Rechtswirksamkeit der am 27.2.2012 geschlossenen schriftlichen Vereinbarung als fraglich erachte, weil es sich um ein Grundstücksgeschäft handele, das der notariellen Beurkundung bedurft habe.
9
Unter dem 28.6.2013 erteilte die Beklagte der Beigeladenen eine Nachtragsgenehmigung, die notwendige Stellplätze bzw. Garagen betraf.
10
Bereits am 14.5.2013 hatte die Klägerin Klage erhoben, die sie im wesentlichen wie folgt begründet hat: Ihr Klagerecht sei nicht verwirkt. Die Beigeladene könne sich nicht auf ein schutzwürdiges Vertrauen berufen, weil sie sich selbst treuwidrig verhalten und die getroffene Vereinbarung über den Tiefgaragenstellplatz nicht erfüllt habe. Die privatschriftliche Vereinbarung sei formnichtig. Ihre Zustimmungserklärung zu dem Bauvorhaben sei mit Schreiben vom 16.9.2013 wirksam angefochten worden. Infolgedessen verstoße die Baugenehmigung gegen ihre Rechte aus § 6 BauO NRW. Zudem sei aufgefallen, dass die Beigeladene seinerzeit einen nicht maßstabsgetreuen Plan vorgelegt habe. Der genehmigte Plan enthalte einen geringeren Abstand. Die erteilte Nachbarzustimmung sei auch deshalb unwirksam, weil die Beigeladene - wie die Beklagte im Sommer 2014 festgestellt habe - weitergehende Verstöße hinsichtlich des Abstandes zu ihrem Grundstück unter anderem beim Bau der Balkone und der Dachgauben verwirklicht habe.
11
Die Klägerin hat beantragt,
12
die der Beigeladenen durch die Beklagte erteilte Baugenehmigung vom 5.4.2012 nebst dazugehörigem Abweichungsbescheid desselben Datums in Gestalt der Nachtragsgenehmigung vom 28.6.2013 aufzuheben.
13
Die Beklagte hat beantragt,
14
die Klage abzuweisen.
15
Sie trägt vor: Die Klägerin habe durch die Unterzeichnung der Bauvorlagen ihre Nachbarzustimmung zu dem genehmigten Bauvorhaben erklärt. Daran sei sie gebunden. Die Nachtragsgenehmigung sei aus nachbarlicher Sicht unerheblich. Ein Widerruf der Zustimmung sei nicht rechtzeitig erfolgt; Anhaltspunkte für eine Unwirksamkeit der Nachbarzustimmung lägen nicht vor.
16
Die Beigeladene hat beantragt,
17
die Klage abzuweisen.
18
Zur Begründung hat sie unter anderem geltend gemacht: Die Klägerin habe wirksam auf ihre Nachbarrechte in verfahrens- wie materiellrechtlicher Hinsicht verzichtet. Die Frage der Formbedürftigkeit der zu Grunde liegenden Vereinbarung betreffe keine Tatsache, über die im Sinne des § 123 BGB arglistig getäuscht worden sein könne. Sie - die Beigeladene - habe auch nicht über ihre Erfüllungsbereitschaft getäuscht, weil sie zunächst bereit gewesen sei, den privatschriftlichen Vertrag zu erfüllen. Sie habe von der Formbedürftigkeit der Vereinbarung selbst keine Kenntnis gehabt und erst nach anwaltlicher Beratung davon erfahren.
19
Mit dem angefochtenen Urteil hat das Verwaltungsgericht der Klage stattgegeben und zur Begründung u.a. ausgeführt, die Zustimmung der Klägerin sei wegen der von der Baugenehmigung abweichenden Bauausführung, die erhebliche Veränderungen umfasse und deshalb als aliud zu bewerten sei, entfallen.
20
Mit ihrer vom Senat zugelassenen Berufung macht die Beigeladene im Wesentlichen geltend: Die Klage sei bereits unzulässig, weil die Klägerin ihr Klagerecht verwirkt habe. Spätestens seit Baubeginn am 12.4.2012 habe sich die Klägerin Kenntnis von der Baugenehmigung verschaffen können, so dass nach allgemeinen Grundsätzen das Klagerecht bei Klageeingang im Mai 2013 bereit verwirkt gewesen sei. Die von der Baugenehmigung abweichende Bauausführung habe keinen Einfluss auf den Bestand der Nachbarzustimmung zur Baugenehmigung. Die Nachbarzustimmung sei auch im Übrigen wirksam, wie bereits im erstinstanzlichen Verfahren dargelegt worden sei. Ergänzend sei auszuführen, dass es zudem an einer wirksamen Anfechtungserklärung fehle, die auch an die Beklagte zu adressieren gewesen sei. Ungeachtet dessen sei fraglich, ob das genehmigte Vorhaben überhaupt gegen § 6 BauO NRW verstoße. Hinsichtlich der Balkone sei zu prüfen, ob sie bei der Berechnung der Abstandflächen gemäß § 6 Abs. 7 BauO NRW außer Betracht bleiben müssten und ob das sogenannte Schmalseitenprivileg nach § 6 Abs. 6 BauO NRW Anwendung finden könne; entsprechendes gelte für die Dachgauben. Bei Dachgauben sei die Annahme einer Abstandfläche dann nicht gerechtfertigt, wenn es sich nur um unselbstständige Bestandteile des Daches handele. Aus den Bauplänen ergebe sich, dass die Dachgauben hinter den Außenwänden des Gebäudes zurückblieben. Die Dachgauben enthielten auch keine Fenster in Richtung des Grundstücks der Klägerin. Die genehmigte Fluchttreppe könne schon deshalb keinen Abstandsverstoß begründen, weil sie unterhalb der Geländeoberfläche liege.
21
Die Beigeladene beantragt,
22
das angefochtene Urteil zu ändern und die Klage abzuweisen.
23
Die Klägerin beantragt,
24
die Berufung zurückzuweisen.
25
Sie trägt im wesentlichen vor: Ihr Klagerecht sei nicht verwirkt. Dafür, dass sie schon bei Baubeginn im April 2012 von der Baugenehmigung Kenntnis hätte haben müssen, habe die Beigeladene nichts vorgetragen. Ungeachtet dessen komme es vorliegend darauf auch nicht an. Denn auch aus Sicht der Beigeladenen habe für die Klägerin erst zu dem Zeitpunkt Anlass bestanden, gegen die Baugenehmigung vorzugehen, zu dem erkennbar geworden sei, dass die Beigeladene ihrer Verpflichtung aus der Vereinbarung aus Februar 2012 nicht nachkommen wolle. Allein die vereinbarungsgemäße Verlegung der zwei Baulaststellplätze habe nicht die Grundlage für einen Vertrauenstatbestand der Beigeladenen schaffen können. Auch sei zu berücksichtigen, dass der für eine Verwirkung maßgebliche Zeitraum erst dann beginne, wenn die Beeinträchtigung der Rechtsposition des Nachbarn ersichtlich geworden sei. Das Verwaltungsgericht sei im Übrigen zu Recht davon ausgegangen, dass die wesentliche Änderung der Bauausführung dazu führe, dass die Nachbarzustimmung ihre Bindungswirkung verliere. Ungeachtet dessen entfiele die Zustimmung aber jedenfalls deshalb, weil die Beigeladene die von ihr versprochene Gegenleistung, von der die Nachbarzustimmung abhängig gewesen sei, nicht erbracht habe. Soweit man eine solche Gegenleistung als mit einer Nachbarzustimmung unvereinbar beurteile, sei die Nachbarzustimmung von vorn herein unwirksam gewesen.
26
Die Beklagte hat keinen Antrag gestellt.
27
Der Berichterstatter hat am 6.3.2018 einen Ortstermin durchgeführt.
28
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakten sowie auf die beigezogenen Verwaltungsvorgänge Bezug genommen.
29
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :
30
Das Berufungsverfahren ist ungeachtet des Umstandes, dass die Beigeladene ausweislich ihres Vorbringens im Ortstermin das Eigentum an dem Vorhabengrundstück - mit Ausnahme eines Tiefgaragenstellplatzes - durch die Übertragung von Wohnungseigentum weitgehend verloren hat, mit den bisherigen Beteiligten fortzusetzen. Denn die Beigeladene hat ihre Stellung als Verfahrensbeteiligte gemäß § 63 Nr. 3 VwGO nicht verloren. Dies folgt aus § 173 VwGO i. V. m. § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO, wonach die Veräußerung einer Sache auf den Prozess keinen Einfluss hat, sondern der Veräußerer den Prozess mit eigener Prozessführungsbefugnis, also im eigenen Namen, weiterführt.
31
Vgl. BVerwG, Beschluss vom 16.12.2015 - 4 B 48.15 -, juris.
32
Dies gilt nach Maßgabe des § 266 Abs. 1 Satz 1 ZPO auch bei der Veräußerung eines Grundstücks. Erst mit der Übernahme des Verfahrens durch den oder die Erwerber scheidet der bisherige Eigentümer aus dem Prozess aus. Eine solche Übernahme ist hier nicht erfolgt.
33
Die zulässige Berufung hat keinen Erfolg. Das Verwaltungsgericht hat die streitige Baugenehmigung im Ergebnis zu Recht aufgehoben.
34
I. Die Klage ist zulässig. Die Klägerin hat insbesondere ihr Klagerecht nicht verwirkt. Dabei kommt es nicht darauf an, ob sie von der Erteilung der Baugenehmigung bereits seit Baubeginn im April 2012 wissen musste, wie die Beigeladene vorträgt. Der Senat folgt vielmehr der Auffassung der Klägerin, dass ein unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben relevanter Vertrauenstatbestand bei der Beigeladenen dahingehend, dass die Klägerin gegen die Baugenehmigung nicht vorgehen werde, nicht vor dem Zeitpunkt entstehen konnte, zu dem die Beigeladene erstmals erkennen ließ, dass sie die Verpflichtung zur Veräußerung des Tiefgaragenstellplatzes aus der Vereinbarung vom 27.2.2012 als rechtlich unverbindlich betrachte. Dies war aber nach dem Inhalt der Akten erst mit dem Schreiben der Beigeladenen vom 12.3.2013 der Fall. Die danach bis zur Klageerhebung am 14.5.2013 verstrichene Zeitspanne reicht indessen nicht aus, um die zeitlichen Anforderungen an die Verwirkung des Klagerechts im Nachbarschaftsverhältnis als erfüllt anzusehen.
35
II. Die Klage ist auch begründet. Die angefochtene Baugenehmigung nebst Abweichungsentscheidung ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO.
36
1. Die Beklagte ist zutreffend davon ausgegangen, dass die beiden Dachaufbauten auf dem genehmigten Gebäude Abstandflächen im Sinne von § 6 BauO NRW auslösen, die seitlich auf das Grundstück der Klägerin fallen. Dies folgt schon daraus, dass es sich ausweislich der Bauvorlagen bei den beiden Dachaufbauten nicht um Dachgauben, sondern um sogenannte Zwerchhäuser handelt:
37
Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW sind vor Außenwänden von Gebäuden Flächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten (Abstandflächen). Unter „Außenwänden“ im Sinne des § 6 BauO NRW sind die über der Geländeoberfläche liegenden Wände zu verstehen, die von außen sichtbar sind und das Gebäude gegen die Außenluft abschließen.
38
Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 17.11. 2009 - 7 B 1350/09 -, BRS 74 Nr. 136.
39
Danach sind die äußeren Begrenzungen des Dachaufbaus als Außenwände grundsätzlich in die Betrachtung einzubeziehen. Eine Beurteilung der äußeren Begrenzung als Außenwand - mit der Folge einer seitlichen Abstandfläche zum Grundstück der Klägerin - ist allerdings dann nicht gerechtfertigt, wenn es sich nur um einen (unselbständigen) Bestandteil des Dachs handelt. Ist ein Dachaufbau bloßer Bestandteil des Dachs, auf dem er errichtet ist, machen seine äußeren Begrenzungen die Einhaltung eigener Abstandflächen nicht erforderlich. Erweist sich ein Dachaufbau dagegen als ein vom Dach losgelöster selbständiger Bauteil, sind seine äußeren Begrenzungen - einschließlich etwaiger Fensterfronten - regelmäßig als Außenwände oder als Teil von Außenwänden des Gebäudes anzusehen, die eigene Abstandflächen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW auslösen.
40
Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 13.1.2004 - 10 B 1811/03 -, BRS 67 Nr. 127 und vom 29.4.2010 - 7 B 201/10 -, juris.
41
Den hier streitigen Dachaufbauten ist schon deshalb die Eigenschaft eines bloßen Dachbestandteils abzusprechen, weil es sich um „Zwerchhäuser“ handelt. Ein Zwerchhaus (zwerch = althochdeutsch für quer) verlängert die Außenwand des Gebäudes über die Traufe hinaus in den Dachbereich; es steigt von der Geländeoberfläche aus bis in den Dachbereich auf und stellt sich dort als Dachaufbau dar; funktional dient es dazu, im Dachbereich zusätzlichen Raum zu schaffen. Seitenwände eines Zwerchhauses lösen als Außenwände seitliche Abstandflächen aus,
42
vgl. OVG NRW, Urteil vom 21.1.1999 - 10 A 4072/97 -, juris,
43
weil es sich bei einem Zwerchhaus nicht um einen unselbständigen Bestandteil des Dachs handelt. Die für das Gebäude genehmigten Dachaufbauten sind Zwerchhäuser in diesem Sinne. Nach den Bauvorlagen stellen sie sich als Verlängerung der Außenwand dar und durchbrechen nicht etwa wie Dachgauben die Dachhaut.
44
Aber auch ungeachtet dessen handelt es sich - wie es die Beklagte im Ergebnis richtig gesehen hat - um einen Dachaufbau, der nicht mehr als Bestandteil des Dachs, sondern als selbständiges Bauteil zu werten ist und deshalb eine seitliche Abstandfläche auslöst.
45
Ob die vorderen bzw. seitlichen äußeren Begrenzungen eines auf einer geneigten Dachfläche errichteten Dachaufbaus die Einhaltung eigener Abstandflächen erforderlich machen oder jedenfalls bei der Berechnung der vor den Außenwänden des Gebäudes einzuhaltenden Abstandflächen berücksichtigt werden müssen, hängt davon ab, wie sie im Einzelfall bei wertender Betrachtung rechtlich zu qualifizieren sind.
46
Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 13.1.2004 - 10 B 1811/03 -, BRS 67 Nr. 127.
47
Als mögliche Kriterien für die vorzunehmende Wertung kommen beispielsweise in Betracht: die Unterordnung des Dachaufbaus nach Ausmaß und Gestaltung im Verhältnis zum Dach, die Funktion des Dachaufbaus und der Umfang der zusätzlichen Auswirkungen, die der Dachaufbau auf die durch die Abstandflächenvorschriften geschützten Belange haben kann.
48
Daran gemessen handelt es sich hier nicht mehr um Bestandteile des Dachs, sondern um als selbständig zu wertende Dachaufbauten. Dies ergibt sich nach dem Eindruck des Berichterstatters bei der Besichtigung der Örtlichkeit, der dem Senat in der Beratung vermittelt worden ist, schon mit Blick auf die Ausmaße des jeweiligen Aufbaus (Breite, Höhe und Tiefe).
49
Soweit sich die Beigeladene auf das so genannte Schmalseitenprivileg nach § 6 Abs. 6 Satz 1 BauO NRW beruft, rechtfertigt dies schon deshalb keine andere Beurteilung, weil auch danach ein Mindestabstand von 3 m einzuhalten ist, der ausweislich der Bauvorlagen durch die Dachaufbauten unterschritten ist. Daraus folgt mit Blick auf die hier planungsrechtlich nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB vorgegebene geschlossene Bauweise, dass der Aufbau entweder die gebotene Abstandfläche hätte einhalten oder grenzständig hätte errichtet werden müssen,
50
vgl. auch OVG NRW, Beschluss vom 17.7.2008 - 7 B 195/08 -, BRS 73 Nr. 119,
51
was nicht der Fall ist.
52
Ob und inwieweit auch im Hinblick auf die Balkone Abstandflächenverstöße gegeben sind, kann hiervon ausgehend offenbleiben.
53
2. Auf diesen Verstoß gegen § 6 BauO NRW kann sich die Klägerin auch berufen. Dies ist ihr insbesondere nicht durch die Zustimmungserklärungen verwehrt, die auf den von der Beigeladenen eingereichten Bauvorlagen vorhanden sind, unter anderem den vorerörterten Abstandflächenverstoß zum Gegenstand haben und auch von der Klägerin als Mitglied der Eigentümergemeinschaft C.---straße 14 unter dem 1.3. 2012 unterzeichnet worden sind. Eine solche Zustimmungs- oder Verzichtserklärung führt nur dann zum dauerhaften Verlust eines Nachbarrechts, wenn sie unwiderrufbar und auch im Übrigen rechtsbeständig ist. Letzteres ist hier nicht der Fall. Dabei kann dahinstehen, ob die Zustimmungserklärung unter dem Gesichtspunkt einer arglistigen Täuschung im Sinne von § 123 BGB wirksam angefochten worden ist. Denn die Zustimmungserklärung war von Beginn an jedenfalls nach den §§ 812 ff. BGB kondizierbar, worauf der erstinstanzliche Berichterstatter im Ortstermin zutreffend hingewiesen hat.
54
Die Zustimmungserklärung der Klägerin war gegenüber der Beigeladenen in Erfüllung der privatschriftlichen Vereinbarung vom 27.2.2012 abgegeben worden, die nach § 125 Satz 1, § 311b Abs. 1 Satz 1 BGB im Hinblick auf den dort geregelten Stellplatzverkauf formnichtig war, was zwischen der Klägerin und der Beigeladenen auch unstreitig ist. Da der Stellplatz bis heute nicht übereignet worden ist, ist der Vertrag auch nicht nach § 311b Abs.l 1 Satz 2 BGB gültig geworden. Infolgedessen liegen hinsichtlich der Zustimmungserklärung die Voraussetzungen eines Anspruchs der Klägerin gegen die Beigeladene aus § 812 Abs. 1 Satz 1 1. Alt. BGB vor, weil die Beigeladene mit der Zustimmungserklärung der Klägerin durch deren Leistung etwas ohne rechtlichen Grund erlangt hat. Der Anspruch ist auch nicht nach § 814 BGB ausgeschlossen, weil die Klägerin gewusst hätte, dass sie nicht zur Leistung verpflichtet war. Zur Überzeugung des Senats lag hinsichtlich des Formmangels der getroffenen privatschriftlichen Vereinbarung bei der Klägerin lediglich Fahrlässigkeit vor, da kein Anhalt für die Annahme besteht, dass - etwa wegen einer juristischen Vorbildung oder besonderer Erfahrung im Immobilienbereich - von einer positiven Kenntnis des Formerfordernisses zum Zeitpunkt der Abgabe der Zustimmungserklärung auszugehen war. Die Beigeladene ist zwar zur Herausgabe des Erlangten im Sinne von § 818 Abs. 2 2. Alt. BGB inzwischen außerstande, weil sie die Zustimmungserklärung mit den Bauvorlagen an die Beklagte weitergeleitet hat. Die Klägerin ist deswegen aber nicht etwa auf einen Anspruch auf Wertersatz nach § 818 Abs. 2 BGB beschränkt. Sie hat vielmehr entsprechend § 822 BGB hinsichtlich der Zustimmungserklärung einen Anspruch auf Herausgabe durch die Beklagte, die die Zustimmungserklärung unentgeltlich im Sinne der letztgenannten Norm, d.h. ohne korrespondierende Gegenleistung, erhalten hat.
55
Da die Klägerin durch ihr Vorbringen auch keinen Zweifel daran gelassen hat, dass sie sich wegen der unterbliebenen Erfüllung der formnichtigen Vereinbarung vom 27.2.2012 von ihrer Zustimmungserklärung lösen möchte, sie ihren Anspruch auf Rückgewähr der Zustimmung - so sie denn wirksam ist - also ausüben möchte, fehlt der Erklärung die notwendige Rechtsbeständigkeit. Sie bot danach weder der von der Beklagten nach § 73 BauO NRW getroffenen Abweichungsentscheidung eine rechtlich tragfähige Grundlage, noch schließt sie darüber hinausgehend eine Berufung der Klägerin auf den gegebenen Abstandflächenverstoß aus.
56
Ob sich die gleiche Beurteilung auch unter dem Gesichtspunkt eines unredlichen Erwerbs der Zustimmungserklärung durch die Beigeladene nach § 242 BGB ergibt, kann hiervon ausgehend dahinstehen. Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben darf niemand aus eigenem unredlichen Verhalten einen rechtlichen Vorteil ziehen.
57
Vgl. etwa Jauernig, BGB, 14. Aufl. § 242 Rn. 44 m. w. N.
58
Insoweit sei lediglich angemerkt, dass hinsichtlich des Geschäftsführers der Beigeladenen wegen seiner Erfahrungen im Immobiliengeschäft anders als bei der Klägerin vieles dafür spricht, dass er die Formnichtigkeit der getroffenen privatschriftlichen Vereinbarung vom 27.2.2012 kannte.
59
Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i. V. m. den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
60
Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 132 Abs. 2 VwGO nicht vorliegen.